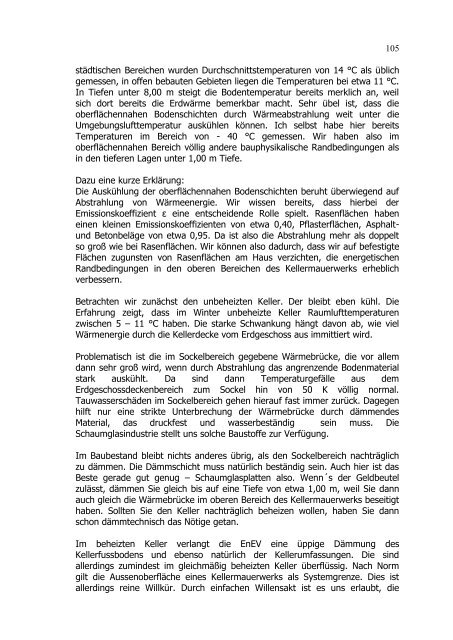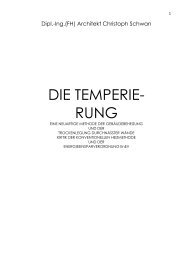Architekt Dipl - termosfassade.info
Architekt Dipl - termosfassade.info
Architekt Dipl - termosfassade.info
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
105<br />
städtischen Bereichen wurden Durchschnittstemperaturen von 14 °C als üblich<br />
gemessen, in offen bebauten Gebieten liegen die Temperaturen bei etwa 11 °C.<br />
In Tiefen unter 8,00 m steigt die Bodentemperatur bereits merklich an, weil<br />
sich dort bereits die Erdwärme bemerkbar macht. Sehr übel ist, dass die<br />
oberflächennahen Bodenschichten durch Wärmeabstrahlung weit unter die<br />
Umgebungslufttemperatur auskühlen können. Ich selbst habe hier bereits<br />
Temperaturen im Bereich von - 40 °C gemessen. Wir haben also im<br />
oberflächennahen Bereich völlig andere bauphysikalische Randbedingungen als<br />
in den tieferen Lagen unter 1,00 m Tiefe.<br />
Dazu eine kurze Erklärung:<br />
Die Auskühlung der oberflächennahen Bodenschichten beruht überwiegend auf<br />
Abstrahlung von Wärmeenergie. Wir wissen bereits, dass hierbei der<br />
Emissionskoeffizient ε eine entscheidende Rolle spielt. Rasenflächen haben<br />
einen kleinen Emissionskoeffizienten von etwa 0,40, Pflasterflächen, Asphalt-<br />
und Betonbeläge von etwa 0,95. Da ist also die Abstrahlung mehr als doppelt<br />
so groß wie bei Rasenflächen. Wir können also dadurch, dass wir auf befestigte<br />
Flächen zugunsten von Rasenflächen am Haus verzichten, die energetischen<br />
Randbedingungen in den oberen Bereichen des Kellermauerwerks erheblich<br />
verbessern.<br />
Betrachten wir zunächst den unbeheizten Keller. Der bleibt eben kühl. Die<br />
Erfahrung zeigt, dass im Winter unbeheizte Keller Raumlufttemperaturen<br />
zwischen 5 – 11 °C haben. Die starke Schwankung hängt davon ab, wie viel<br />
Wärmenergie durch die Kellerdecke vom Erdgeschoss aus immittiert wird.<br />
Problematisch ist die im Sockelbereich gegebene Wärmebrücke, die vor allem<br />
dann sehr groß wird, wenn durch Abstrahlung das angrenzende Bodenmaterial<br />
stark auskühlt. Da sind dann Temperaturgefälle aus dem<br />
Erdgeschossdeckenbereich zum Sockel hin von 50 K völlig normal.<br />
Tauwasserschäden im Sockelbereich gehen hierauf fast immer zurück. Dagegen<br />
hilft nur eine strikte Unterbrechung der Wärmebrücke durch dämmendes<br />
Material, das druckfest und wasserbeständig sein muss. Die<br />
Schaumglasindustrie stellt uns solche Baustoffe zur Verfügung.<br />
Im Baubestand bleibt nichts anderes übrig, als den Sockelbereich nachträglich<br />
zu dämmen. Die Dämmschicht muss natürlich beständig sein. Auch hier ist das<br />
Beste gerade gut genug – Schaumglasplatten also. Wenn´s der Geldbeutel<br />
zulässt, dämmen Sie gleich bis auf eine Tiefe von etwa 1,00 m, weil Sie dann<br />
auch gleich die Wärmebrücke im oberen Bereich des Kellermauerwerks beseitigt<br />
haben. Sollten Sie den Keller nachträglich beheizen wollen, haben Sie dann<br />
schon dämmtechnisch das Nötige getan.<br />
Im beheizten Keller verlangt die EnEV eine üppige Dämmung des<br />
Kellerfussbodens und ebenso natürlich der Kellerumfassungen. Die sind<br />
allerdings zumindest im gleichmäßig beheizten Keller überflüssig. Nach Norm<br />
gilt die Aussenoberfläche eines Kellermauerwerks als Systemgrenze. Dies ist<br />
allerdings reine Willkür. Durch einfachen Willensakt ist es uns erlaubt, die