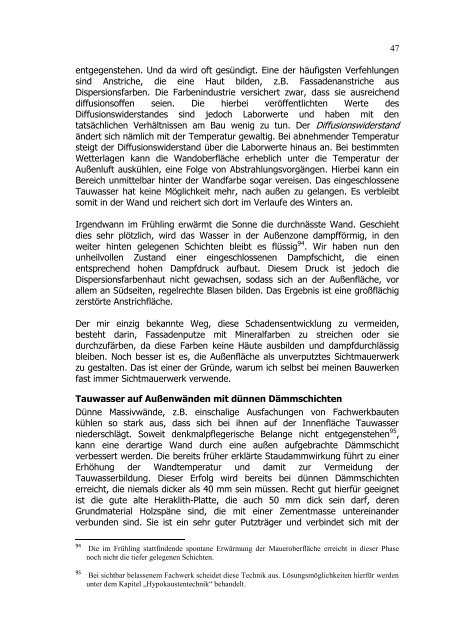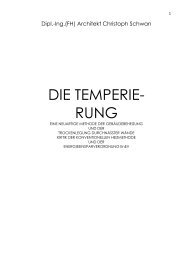Architekt Dipl - termosfassade.info
Architekt Dipl - termosfassade.info
Architekt Dipl - termosfassade.info
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
entgegenstehen. Und da wird oft gesündigt. Eine der häufigsten Verfehlungen<br />
sind Anstriche, die eine Haut bilden, z.B. Fassadenanstriche aus<br />
Dispersionsfarben. Die Farbenindustrie versichert zwar, dass sie ausreichend<br />
diffusionsoffen seien. Die hierbei veröffentlichten Werte des<br />
Diffusionswiderstandes sind jedoch Laborwerte und haben mit den<br />
tatsächlichen Verhältnissen am Bau wenig zu tun. Der Diffusionswiderstand<br />
ändert sich nämlich mit der Temperatur gewaltig. Bei abnehmender Temperatur<br />
steigt der Diffusionswiderstand über die Laborwerte hinaus an. Bei bestimmten<br />
Wetterlagen kann die Wandoberfläche erheblich unter die Temperatur der<br />
Außenluft auskühlen, eine Folge von Abstrahlungsvorgängen. Hierbei kann ein<br />
Bereich unmittelbar hinter der Wandfarbe sogar vereisen. Das eingeschlossene<br />
Tauwasser hat keine Möglichkeit mehr, nach außen zu gelangen. Es verbleibt<br />
somit in der Wand und reichert sich dort im Verlaufe des Winters an.<br />
Irgendwann im Frühling erwärmt die Sonne die durchnässte Wand. Geschieht<br />
dies sehr plötzlich, wird das Wasser in der Außenzone dampfförmig, in den<br />
weiter hinten gelegenen Schichten bleibt es flüssig 94 . Wir haben nun den<br />
unheilvollen Zustand einer eingeschlossenen Dampfschicht, die einen<br />
entsprechend hohen Dampfdruck aufbaut. Diesem Druck ist jedoch die<br />
Dispersionsfarbenhaut nicht gewachsen, sodass sich an der Außenfläche, vor<br />
allem an Südseiten, regelrechte Blasen bilden. Das Ergebnis ist eine großflächig<br />
zerstörte Anstrichfläche.<br />
Der mir einzig bekannte Weg, diese Schadensentwicklung zu vermeiden,<br />
besteht darin, Fassadenputze mit Mineralfarben zu streichen oder sie<br />
durchzufärben, da diese Farben keine Häute ausbilden und dampfdurchlässig<br />
bleiben. Noch besser ist es, die Außenfläche als unverputztes Sichtmauerwerk<br />
zu gestalten. Das ist einer der Gründe, warum ich selbst bei meinen Bauwerken<br />
fast immer Sichtmauerwerk verwende.<br />
Tauwasser auf Außenwänden mit dünnen Dämmschichten<br />
Dünne Massivwände, z.B. einschalige Ausfachungen von Fachwerkbauten<br />
kühlen so stark aus, dass sich bei ihnen auf der Innenfläche Tauwasser<br />
niederschlägt. Soweit denkmalpflegerische Belange nicht entgegenstehen 95 ,<br />
kann eine derartige Wand durch eine außen aufgebrachte Dämmschicht<br />
verbessert werden. Die bereits früher erklärte Staudammwirkung führt zu einer<br />
Erhöhung der Wandtemperatur und damit zur Vermeidung der<br />
Tauwasserbildung. Dieser Erfolg wird bereits bei dünnen Dämmschichten<br />
erreicht, die niemals dicker als 40 mm sein müssen. Recht gut hierfür geeignet<br />
ist die gute alte Heraklith-Platte, die auch 50 mm dick sein darf, deren<br />
Grundmaterial Holzspäne sind, die mit einer Zementmasse untereinander<br />
verbunden sind. Sie ist ein sehr guter Putzträger und verbindet sich mit der<br />
94 Die im Frühling stattfindende spontane Erwärmung der Maueroberfläche erreicht in dieser Phase<br />
noch nicht die tiefer gelegenen Schichten.<br />
95 Bei sichtbar belassenem Fachwerk scheidet diese Technik aus. Lösungsmöglichkeiten hierfür werden<br />
unter dem Kapitel „Hypokaustentechnik“ behandelt.<br />
47