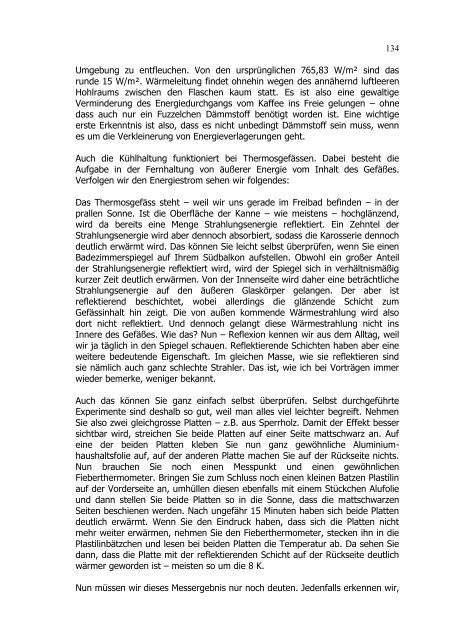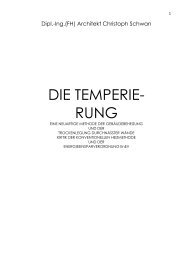Architekt Dipl - termosfassade.info
Architekt Dipl - termosfassade.info
Architekt Dipl - termosfassade.info
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
134<br />
Umgebung zu entfleuchen. Von den ursprünglichen 765,83 W/m² sind das<br />
runde 15 W/m². Wärmeleitung findet ohnehin wegen des annähernd luftleeren<br />
Hohlraums zwischen den Flaschen kaum statt. Es ist also eine gewaltige<br />
Verminderung des Energiedurchgangs vom Kaffee ins Freie gelungen – ohne<br />
dass auch nur ein Fuzzelchen Dämmstoff benötigt worden ist. Eine wichtige<br />
erste Erkenntnis ist also, dass es nicht unbedingt Dämmstoff sein muss, wenn<br />
es um die Verkleinerung von Energieverlagerungen geht.<br />
Auch die Kühlhaltung funktioniert bei Thermosgefässen. Dabei besteht die<br />
Aufgabe in der Fernhaltung von äußerer Energie vom Inhalt des Gefäßes.<br />
Verfolgen wir den Energiestrom sehen wir folgendes:<br />
Das Thermosgefäss steht – weil wir uns gerade im Freibad befinden – in der<br />
prallen Sonne. Ist die Oberfläche der Kanne – wie meistens – hochglänzend,<br />
wird da bereits eine Menge Strahlungsenergie reflektiert. Ein Zehntel der<br />
Strahlungsenergie wird aber dennoch absorbiert, sodass die Karosserie dennoch<br />
deutlich erwärmt wird. Das können Sie leicht selbst überprüfen, wenn Sie einen<br />
Badezimmerspiegel auf Ihrem Südbalkon aufstellen. Obwohl ein großer Anteil<br />
der Strahlungsenergie reflektiert wird, wird der Spiegel sich in verhältnismäßig<br />
kurzer Zeit deutlich erwärmen. Von der Innenseite wird daher eine beträchtliche<br />
Strahlungsenergie auf den äußeren Glaskörper gelangen. Der aber ist<br />
reflektierend beschichtet, wobei allerdings die glänzende Schicht zum<br />
Gefässinhalt hin zeigt. Die von außen kommende Wärmestrahlung wird also<br />
dort nicht reflektiert. Und dennoch gelangt diese Wärmestrahlung nicht ins<br />
Innere des Gefäßes. Wie das? Nun – Reflexion kennen wir aus dem Alltag, weil<br />
wir ja täglich in den Spiegel schauen. Reflektierende Schichten haben aber eine<br />
weitere bedeutende Eigenschaft. Im gleichen Masse, wie sie reflektieren sind<br />
sie nämlich auch ganz schlechte Strahler. Das ist, wie ich bei Vorträgen immer<br />
wieder bemerke, weniger bekannt.<br />
Auch das können Sie ganz einfach selbst überprüfen. Selbst durchgeführte<br />
Experimente sind deshalb so gut, weil man alles viel leichter begreift. Nehmen<br />
Sie also zwei gleichgrosse Platten – z.B. aus Sperrholz. Damit der Effekt besser<br />
sichtbar wird, streichen Sie beide Platten auf einer Seite mattschwarz an. Auf<br />
eine der beiden Platten kleben Sie nun ganz gewöhnliche Aluminiumhaushaltsfolie<br />
auf, auf der anderen Platte machen Sie auf der Rückseite nichts.<br />
Nun brauchen Sie noch einen Messpunkt und einen gewöhnlichen<br />
Fieberthermometer. Bringen Sie zum Schluss noch einen kleinen Batzen Plastilin<br />
auf der Vorderseite an, umhüllen diesen ebenfalls mit einem Stückchen Alufolie<br />
und dann stellen Sie beide Platten so in die Sonne, dass die mattschwarzen<br />
Seiten beschienen werden. Nach ungefähr 15 Minuten haben sich beide Platten<br />
deutlich erwärmt. Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich die Platten nicht<br />
mehr weiter erwärmen, nehmen Sie den Fieberthermometer, stecken ihn in die<br />
Plastilinbätzchen und lesen bei beiden Platten die Temperatur ab. Da sehen Sie<br />
dann, dass die Platte mit der reflektierenden Schicht auf der Rückseite deutlich<br />
wärmer geworden ist – meisten so um die 8 K.<br />
Nun müssen wir dieses Messergebnis nur noch deuten. Jedenfalls erkennen wir,