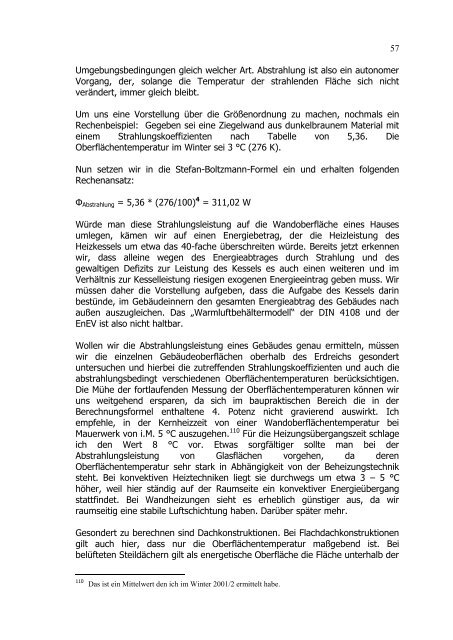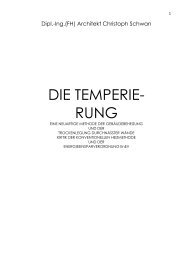Architekt Dipl - termosfassade.info
Architekt Dipl - termosfassade.info
Architekt Dipl - termosfassade.info
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Umgebungsbedingungen gleich welcher Art. Abstrahlung ist also ein autonomer<br />
Vorgang, der, solange die Temperatur der strahlenden Fläche sich nicht<br />
verändert, immer gleich bleibt.<br />
Um uns eine Vorstellung über die Größenordnung zu machen, nochmals ein<br />
Rechenbeispiel: Gegeben sei eine Ziegelwand aus dunkelbraunem Material mit<br />
einem Strahlungskoeffizienten nach Tabelle von 5,36. Die<br />
Oberflächentemperatur im Winter sei 3 °C (276 K).<br />
Nun setzen wir in die Stefan-Boltzmann-Formel ein und erhalten folgenden<br />
Rechenansatz:<br />
ΦAbstrahlung = 5,36 * (276/100) 4 = 311,02 W<br />
Würde man diese Strahlungsleistung auf die Wandoberfläche eines Hauses<br />
umlegen, kämen wir auf einen Energiebetrag, der die Heizleistung des<br />
Heizkessels um etwa das 40-fache überschreiten würde. Bereits jetzt erkennen<br />
wir, dass alleine wegen des Energieabtrages durch Strahlung und des<br />
gewaltigen Defizits zur Leistung des Kessels es auch einen weiteren und im<br />
Verhältnis zur Kesselleistung riesigen exogenen Energieeintrag geben muss. Wir<br />
müssen daher die Vorstellung aufgeben, dass die Aufgabe des Kessels darin<br />
bestünde, im Gebäudeinnern den gesamten Energieabtrag des Gebäudes nach<br />
außen auszugleichen. Das „Warmluftbehältermodell“ der DIN 4108 und der<br />
EnEV ist also nicht haltbar.<br />
Wollen wir die Abstrahlungsleistung eines Gebäudes genau ermitteln, müssen<br />
wir die einzelnen Gebäudeoberflächen oberhalb des Erdreichs gesondert<br />
untersuchen und hierbei die zutreffenden Strahlungskoeffizienten und auch die<br />
abstrahlungsbedingt verschiedenen Oberflächentemperaturen berücksichtigen.<br />
Die Mühe der fortlaufenden Messung der Oberflächentemperaturen können wir<br />
uns weitgehend ersparen, da sich im baupraktischen Bereich die in der<br />
Berechnungsformel enthaltene 4. Potenz nicht gravierend auswirkt. Ich<br />
empfehle, in der Kernheizzeit von einer Wandoberflächentemperatur bei<br />
Mauerwerk von i.M. 5 °C auszugehen. 110 Für die Heizungsübergangszeit schlage<br />
ich den Wert 8 °C vor. Etwas sorgfältiger sollte man bei der<br />
Abstrahlungsleistung von Glasflächen vorgehen, da deren<br />
Oberflächentemperatur sehr stark in Abhängigkeit von der Beheizungstechnik<br />
steht. Bei konvektiven Heiztechniken liegt sie durchwegs um etwa 3 – 5 °C<br />
höher, weil hier ständig auf der Raumseite ein konvektiver Energieübergang<br />
stattfindet. Bei Wandheizungen sieht es erheblich günstiger aus, da wir<br />
raumseitig eine stabile Luftschichtung haben. Darüber später mehr.<br />
Gesondert zu berechnen sind Dachkonstruktionen. Bei Flachdachkonstruktionen<br />
gilt auch hier, dass nur die Oberflächentemperatur maßgebend ist. Bei<br />
belüfteten Steildächern gilt als energetische Oberfläche die Fläche unterhalb der<br />
110 Das ist ein Mittelwert den ich im Winter 2001/2 ermittelt habe.<br />
57