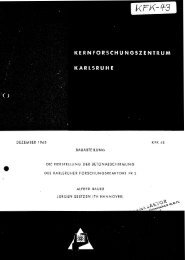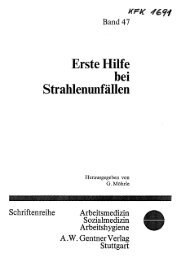bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
menten <strong>und</strong> ihr Einfluß auf die 1nterpretation der<br />
Meßergebnisse behandelt. Als Parameter wurden die<br />
Nutgeometrie, die Einbautiefe des Thermoelementes,<br />
das Lötmaterial, veränderliche Kontaktzahlen (Isolator-Hülle)<br />
<strong>und</strong> die Leistungsdichte variiert.<br />
Zur Ermittlung des Wärmeüberganges in Bündelströmungen<br />
wurd.e eine Stabdrehvorrichtung erprobt <strong>und</strong><br />
konstruktive Möglichkeiten zum Bau von Bündeln aus<br />
elektrisch beheizten Stäben hoher Leistung bearbeitet.<br />
Für Vergleichsmessungen wurde ein Wasserkreislauf<br />
(100 m 3 /h, 12 kp/cm 2 ) fertiggestellt.<br />
Zur S<strong>im</strong>ulation von Kernbrennstäben wurden elektrische<br />
Heizstäbe entwickelt, die es gestatten, Brennelemente<br />
schneller Reaktoren bei deren thermischen<br />
Auslegungsdaten zu untersuchen. Die Heizstäbe bestehen<br />
aus 2 konzentrischen Rohren aus Edelstahl<br />
oder Nickelbasislegierungen. Sie sind gegeneinander<br />
mit Born itrid (BN) elektrisch isoliert. Das innere<br />
Rohr dient als Stromleiter. Es ist in der beheizten<br />
Zone mit einer Stützkeramik gefüllt, in der unbeheizten<br />
mit einem Metallbolzen ho her elektrischer<br />
Leitfähigkeit. Die beschriebenen Stäbe sind seit Ende<br />
1969 verfügbar. Die Entwicklung 1970 befaßte sich<br />
hauptsächlich mit dem Austausch des bis dahin verwendeten<br />
heißgepreßten BN durch BN-Pulver, das <strong>im</strong><br />
Stab auf die Dichte des heißgepreßten BN verdichtet<br />
wird. Diese neu entwickelten Stäbe bringen folgende<br />
Vorteile:<br />
BN-Pulver besitzt aufgr<strong>und</strong> seines geringeren<br />
B 2 0 3 -Anteiles bessere elektrische Isolationseigenschaften,<br />
was den Betrieb der Heizstäbe bei höheren<br />
Stromleitertemperaturen erlaubt.<br />
Heizstäbe mit BN-Pulver erfordern einen wesentlich<br />
geringeren Material- <strong>und</strong> Fertigungsaufwand.<br />
Die beschriebenen Heizstäbe wurden bisher mit einem<br />
Außendurchmesser von 5,65 - 6,2 mm <strong>und</strong> einer<br />
. Länge von 400 - 1300 mm hergestellt. Ein Prototypstab<br />
wurde in einem Langzeitversuch über 2000 St<strong>und</strong>en<br />
erprobt.<br />
Um das Verhalten der Abstützstellen der Brennstäbe<br />
<strong>im</strong> Bündel zu ermitteln <strong>und</strong> den Metallabtrag an den<br />
Berührungsflächen der Wendelrippen zu best<strong>im</strong>men,<br />
wurde ein 61-Stabbündel aus 6 Rippenrohren fertiggesteIlt.<br />
Das Bündel besitzt die Abmessungen des<br />
SNR-Brennelementes. Die Brennstäbe sind mit StahlpeIlets<br />
gefüllt. Das Modell-Brennelement wird z. Zt.<br />
<strong>im</strong> Langzeitversuch bei Na-Temperaturen von 600°C<br />
erprobt.<br />
7/69/23 Korrosionsuntersuchungen<br />
Die Teststrecken des Korrosionskreislaufes JJ Cerberus"<br />
waren mit Proben aus austenitischen Stählen,<br />
Nickelbasislegierungen, unlegierten Metallen wie<br />
Eisen <strong>und</strong> Nickel sowie Vanadiumlegierungen be-<br />
stückt. Die Versuchsparameter waren, wie schon bei<br />
früheren Versuchsreihen bis auf den Sauerstoffgehalt<br />
konstant (550 <strong>und</strong> 600°C in den Testteilen <strong>und</strong><br />
0,5 m/sec Natriumgeschwindigkeit an den Proben).<br />
Um den Einfluß des Sauerstoffs auf die Korrosionsrate<br />
zu ermitteln, wurden bei den insgesamt 4 Versuchsreihen<br />
mit einer Gesamtbetriebszeit von 5.200<br />
St<strong>und</strong>en der Sauerstoffgehalt <strong>im</strong> Kreislauf von Versuch<br />
zu Versuch durch Veränderung der Kaltfallentemperatur<br />
variiert. Es konnte festgestellt werden,<br />
daß bei den austenitischen Stählen die Korrosionsgeschwindigkeit<br />
stark vom Sauerstoffgehalt <strong>im</strong> Natrium<br />
abhängig ist, während bei den eingesetzten Nickelproben<br />
diese Abhängigkeit nicht vorhanden ist. Der<br />
austenitische Werkstoff Nr. 4981 zeigte bei diesen<br />
Versuchen die geringste Abtragung. Die Untersuchungen<br />
an den eingesezten Armco-Eisen-Proben zeigten<br />
ein ähnliches Korrosionsverhalten wie die austenitischen<br />
Stähle.<br />
Die Gesamtbetriebszeit des Kreislaufes "Cerberus"<br />
beläuft sich nunmehr auf über 20.000 St<strong>und</strong>en Versuchsbetrieb.<br />
Die Rohrleitungs- <strong>und</strong> Komponenten-Montage des<br />
Hochtemperaturkreis/aufes in dem Korrosionsuntersuchungen<br />
bei einer Natriumtemperatur bis 800°C<br />
<strong>und</strong> Strömungsgeschwindigkeit bis zu 12 m/sec<br />
durchgeführt werden können, wurde abgeschlossen.<br />
Röntgenprüfungen der Schweißnähte, Druckprüfung<br />
<strong>und</strong> Heliumdichtigkeitsprüfungen der Gesamtanlage<br />
wurden erfolgreich beendet. Die Rohrbegleitheizungen,<br />
die Temperaturmeßstelien <strong>und</strong> die Wärmeisolation<br />
wurden angebracht. Parallel hierzu erfolgte die<br />
Vormontage der regel baren elektrischen Einspeisungen<br />
für die 3 Teststrecken mit einer Leistung von je<br />
90 kVA.<br />
Im Anschluß an die Rohrmontage des Hochtemperaturkreislaufes<br />
wurden die 3 Massetransportkreis/äufe<br />
die zuvor in der alten Versuchshalle demontiert <strong>und</strong><br />
von Natriumresten gereinigt wurden, in der erweiterten<br />
Versuchshalle montiert. Die Versorugng der 3<br />
identischen Kreisläufe mit Natrium, die mit einer<br />
elektromagnetischen Pumpe betrieben werden <strong>und</strong> für<br />
eine max<strong>im</strong>ale Versuchstemperatur von 650°C ausgelegt<br />
sind, erfolgt durch einen gemeinsamen Gr<strong>und</strong>kreis,<br />
der aus einem Reinigungs- <strong>und</strong> einem Oxidmeßkreis<br />
besteht. Die Röntgen- <strong>und</strong> Dichtigkeitsprüfungen<br />
wurden abgeschlossen. Die Rohrbegleitheizungen<br />
wurden verlegt <strong>und</strong> die Temperaturmeßstelien angebracht.<br />
Die Messung des Oxidgehalts erfolgte bei den Versuchsreihen<br />
<strong>im</strong> Korrosionskreislauf Cerberus durch<br />
die seit 14.000 Betriebsst<strong>und</strong>en eingebaute kontinuierlich<br />
anzeigende Festelektrolytzelle (Sonde I), die<br />
bei einer Natriumtemperatur von 310°C arbeitet.<br />
Eine zweite, parallel eingebaute Sonde I1 wurde in Betrieb<br />
genommen <strong>und</strong> geeicht. Anschließend wurde<br />
114












![{A1[]Sp - Bibliothek](https://img.yumpu.com/21908054/1/184x260/a1sp-bibliothek.jpg?quality=85)