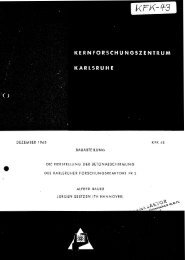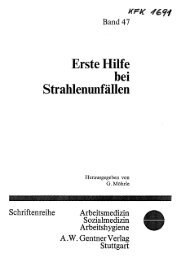bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
fungen liefert, hängt nicht zuletzt davon ab, wie die<br />
bei der Behandlung solcher Verstopfungen auftretenden<br />
Rechenprobleme gelöst werden können.<br />
Lokales Sieden<br />
Zur Beschreibung der Vorgänge bei lokalem Natriumsieden<br />
wurde ein theoretisches Modell entwickelt.<br />
Dem Modell liegt die Annahme des EinzeIblasensiedens<br />
bei erheblichem Siedeverzug zugr<strong>und</strong>e. Es berücksichtigt<br />
die thermohydraulischen Besonderheiten<br />
eines Brennstabbündels. In der numerischen Rechnung<br />
wurde u. a. der Einfluß des Siedeverzugs <strong>und</strong><br />
des Temperaturfeldes in dem kühlungsgestörten Bereich<br />
parametrisch untersucht. Die Ergebnisse der<br />
Analyse lassen erwarten, daß selbst bei hoher Siedeüberhitzung<br />
von mehr als 100°C die einzelnen Dampfblasen<br />
innerhalb von etwa 30 msec vollständig kondensieren<br />
<strong>und</strong> daß eine überhitzung der Brennstabhüll<br />
rohre innerhalb der Dampfblasen während dieser<br />
Zeit ausgeschlossen werden kann. Ein weiteres wichtiges<br />
Ergebnis ist, daß bei erheblichem Siedeverzug die<br />
rasche Volumenänderung einzelner Siedeblasen<br />
Schwankungen der Kühlmittelgeschwindigkeit am<br />
Brennelementaustritt verursacht, die mit einem elektromagnetischen<br />
Durchflußmesser detektierbar sind.<br />
Diese auf theoretischem Weg gewonnenen Ergebnisse<br />
bedürfen noch einer exper<strong>im</strong>entellen Bestätigung, vor<br />
allem wegen der Unsicherheit in den Annahmen über<br />
die auftretende Siedeüberhitzung <strong>und</strong> die Temperaturverteilung<br />
in kühlungsgestörten Zonen eines Brennelements.<br />
Integrale Kühlungsstörungen<br />
Die exper<strong>im</strong>entellen Arbeiten zum Kühlmittelsieden<br />
in Brennelementen schneller Reaktoren wurden für<br />
den Fall integraler Kühlmitteldurchsatzstörungen abgeschlossen.<br />
Im Natriumsiedekreislauf (NSK) wurden<br />
in einer Teststrecke mit Ringspaltgeometrie (dh =<br />
4 mm), die den hydraulischen Verhältnissen eines<br />
Unterkanals des SNR-Brennelementes (dh = 5 mm)<br />
weitgehend entspricht, weitere 70 erfolgreiche Versuche<br />
durchgeführt. Die Versuche lieferten vertiefte<br />
Erkenntnisse zu folgenden drei Problemkreisen:<br />
1. Natriumejektion ausgehend von einer vollständigen<br />
Blockade des Kühlkanals bei hoher Heizleistung «<br />
100 W/cm 2 ). Hier wurden die Vor<strong>jahre</strong>sergebnisse,<br />
die mit rohrförmigen Teststrecken gewonnen wurden,<br />
weitgehend bestätigt. Auf Gr<strong>und</strong> des geringeren<br />
hydraulischen Durchmessers der Ringspaltgeometrie<br />
gegenüber den Versuchen mit rohrförmigen<br />
Teststrecken (dh = 9 -12 mm) waren folgende<br />
Phänomene stärker ausgeprägt:<br />
Das Natrium dringt nach der Siedeejektion<br />
praktisch nicht mehr in den beheizten Teil der<br />
Teststrecke ein.<br />
Der vom Pr<strong>im</strong>ärausstoß verbleibende Natrium<br />
Restfilm ist sehr dünn. Eine Kühlung durch<br />
Restfilmverdampfung ist daher <strong>im</strong> Falle der<br />
Siedeejektion fast vernachlässigbar.<br />
Der Druckverlust in der Dampfströmung ist so<br />
groß, daß in einer größeren Zahl von Exper<strong>im</strong>enten<br />
die Schallgeschwindigkeit erreicht wurde.<br />
Dies führt dazu, daß während der ohnehin<br />
schon sehr kurzen Zeit der Filmkühlung die<br />
Temperaturen <strong>im</strong> Kanal weiter ansteigen.<br />
2. Natriumejektion, ausgehend von einer vollständigen<br />
Blockade des Kühlkanals bei niedriger Heizleistung<br />
« 40 W/cm 2 ). Zur Beurteilung von Problemen<br />
der Nachglühwärmeabfuhr aus dem SNR wurde<br />
untersucht, welche Wärmeleistungen an einem<br />
Kühlkanal unter der oben angegebenen Randbedingung<br />
stationär abführbar sind.<br />
Für den SN R-Unterkanal liegt die Grenze bei<br />
einer spez. Leistung von 10 ~ 15 W/cm 2 •<br />
Die kompakte Natriumsäule dringt nicht oder<br />
nur unwesentlich in den Kanal vor. Die Kühlung<br />
wird durch einen an den Oberflächen entgegen<br />
der Dampfströmung herabrieselnden Film bewirkt.<br />
3. Natriumsieden bei Zwanskonvektion <strong>und</strong> stark gedrosseltem<br />
Du rchsatz.<br />
Stationäres Sieden konnte nur dann erreicht<br />
werden, wenn geringe Gasmengen in die<br />
Kühlmittelströmung injiziert wurden. Das Auftreten<br />
von Siedeverzügen wurde damit unterb<strong>und</strong>en.<br />
Ohne Gasinjektion stellte sich pulsierendes Sieden<br />
ein. Der kritische Wärmefluß wird dann<br />
schon bei geringer spez. Heizflächenleistung<br />
<strong>und</strong> kleinerem Dampfgehalt erreicht. Eine zusammenhängende<br />
analytische Darstellung dieses<br />
Siedephänomens ist z. Z. nicht möglich.<br />
Der kritische Wärmefluß für die Testanordnung<br />
be<strong>im</strong> staionären Sieden ist mittels Grenzkurven<br />
in Abhängigkeit von Dampfgehalt <strong>und</strong> Siededruck<br />
darstellbar, Für die Bedingungen des SNR<br />
wurde durch Extrapolation der Versuchsergebnisse<br />
der kritische Wärmefluß zu 200 W/cm 2<br />
bei einem Dampfgehalt von X=0,15 besti mmt.<br />
über die theoretischen <strong>und</strong> exper<strong>im</strong>entellen Arbeiten<br />
auf dem Gebiet des Kühlmittelsiedens in Natrium<br />
Reaktoren wurde auf verschiedenen Konferenzen <strong>und</strong><br />
in Zeitschriften <strong>bericht</strong>et (3947, 3951, 3957, 3962,<br />
3967, 3975). Als Ergänzung zu den beschriebenen<br />
Arbeiten wurden die 1969 begonnenen stationären<br />
Siedeexper<strong>im</strong>ente (3948, 3977) <strong>im</strong> NSK fortgesetzt.<br />
Zur S<strong>im</strong>ulation der <strong>im</strong> Reaktor vorliegenden Bedingungen<br />
(lange Kühlkanäle, konstante Druckdifferenz<br />
zwischen Ein- <strong>und</strong> Austritt) war die Teststrecke mit<br />
einem vorgeschalteten Drosselventil <strong>und</strong> einem unbeheizten<br />
Bypass versehen. Die spez. Flächenleistung<br />
wurde zwischen 100 <strong>und</strong> 450 W/cm 2 variiert.<br />
123












![{A1[]Sp - Bibliothek](https://img.yumpu.com/21908054/1/184x260/a1sp-bibliothek.jpg?quality=85)