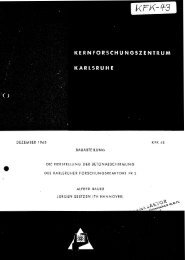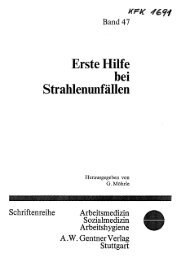bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Regel- <strong>und</strong> Abschaltstäbe werden zur Unterdrückung<br />
der Schwellverbiegung der Führungsrohre<br />
relativ kalt gefahren.<br />
4. Anstelle von axialen <strong>und</strong> radialen Uranbrutmänteln<br />
werden Nickel- oder Stahlreflektoren eingesetzt.<br />
Der radiale Nickel- oder Stahlreflektor wird<br />
ebenfalls relativ kalt gefahren <strong>und</strong> bildet so einen<br />
Stützmantel für die Treiberzone, der lediglich in<br />
der Kopfebene aktiv verspannt werden muß.<br />
5. Die max<strong>im</strong>al mögliche positive Void-Reaktivität<br />
liegt bei dem relativ kleinen FR 3-Core weit unter<br />
einem Dollar, nämlich zwischen 10 bis 20 Cent.<br />
6. Für die vorgesehenen großen Testloops <strong>im</strong> FR 3<br />
wurden technisch <strong>und</strong> ökonomisch realisierbare<br />
Lösungen erarbeitet.<br />
7. Für die Abfuhr der Leistung aus der Treiberzone<br />
wurden vier pr<strong>im</strong>äre <strong>und</strong> vier sek<strong>und</strong>äre Natriumkreisläufe<br />
vorgesehen. Das bedeutet, daß die Reaktorleistung<br />
der ersten Flußstufe (1,0'10 16<br />
n/cm 2 sec) entweder mit drei Kreisläufen - mit jeweils<br />
100 %-er Leistung - oder aber mit allen vier<br />
Kreisläufen, jedoch bei jeweils 75 % Nennleistung<br />
abgeführt werden kann. Dadurch ergibt sich eine<br />
hohe Red<strong>und</strong>anz <strong>und</strong> Verfügbarkeit der Anlage für<br />
Testzwecke.<br />
8. Die Standzeit der Treiberzone beträgt in der ersten<br />
Ausbaustufe 231 Vollasttage <strong>und</strong> in der zweiten<br />
Ausbaustufe 113 Vollasttage, jeweils <strong>im</strong> Dreierzyklus.<br />
9. Die Brennstoffzykluskosten betragen in der ersten<br />
Ausbaustufe mit Uranbrutmantel 10,4 Mill DM<br />
pro Jahr <strong>und</strong> mit Stahl- oder Nickelreflektor<br />
10,6 Mill DM pro Jahr. D. h., daß aufgr<strong>und</strong> der viel<br />
günstigeren Verteilung des Neutronenflusses ein<br />
Stahl- oder Nickelreflektor in jedem Fall einem<br />
Uranbrutmantel vorzuziehen ist.<br />
In der zweiten Ausbaustufe mit dem Zielfluß<br />
1,5'10 16 n/cm 2 sec ergeben sich Brennstoffzykluskosten<br />
von etwa 25 Mill DM pro Jahr.<br />
10. Die gesamten Betriebskosten, inklusive der Brennstoffzykluskosten,<br />
belaufen sich in der ersten Ausbaustufe<br />
auf 37 Mill DM pro Jahr <strong>und</strong> in der zweiten<br />
Ausbaustufe auf etwa 50 Mill DM pro Jahr.<br />
11. Die Anlagekosten wurden auf der Preisbasis von<br />
1970 von Interatom ermittelt. Bei dieser Kostenermittlung<br />
wurden Sicherheitszuschläge für das technische<br />
Risiko, Schwierigkeiten be<strong>im</strong> Bau <strong>und</strong> für<br />
Unvollständigkeit der Unterlagen, Gewinn- <strong>und</strong><br />
Gemeinkosten berücksichtigt. Ferner wurden für<br />
das baubegleitende Engineering <strong>und</strong> Forschung<br />
<strong>und</strong> Entwicklung 10% der Baukosten eingesetzt.<br />
Ebenfalls in den Anlagekosten enthalten sind 7/3<br />
Coreladungen als Erstausstattung, Prozeßrechner<br />
<strong>und</strong> Exper<strong>im</strong>entierüberwachung. Das ergibt in der<br />
Summe Anlagekosten von 523 Mill DM.<br />
8/68/3 Gr<strong>und</strong>lagenuntersuchungen zur<br />
Zweiphasendynamik<br />
8/68/31 Zweiphasenuntersuchungen<br />
Die Untersuchungen zur Ausbreitung schwacher<br />
Kompressionswellen in homogenen Luft/Wasser-Blasengem<br />
ischen bei Raumbedingungen wurden fortgeführt.<br />
Dazu wurde der Lauf der bislang verwendeten<br />
Stoßrohranlage aus Plexiglas von 2,5 m auf 5 m verlängert.<br />
Mit der erweiterten Versuchsanordnung<br />
konnte gezeigt werden, daß sich die untersuchten<br />
Kompressionswellen bereits nach etwa 1 m Lauflänge<br />
zu Stoßwellen aufsteilen <strong>und</strong> über eine Strecke von 2<br />
bis 3 m stabil bleiben <strong>und</strong> dann wieder abflachen. Im<br />
einzelnen wurde festgestellt, daß die Ausbreitungsgeschwindigkeit<br />
der Stoßwellen - mit Ausnahme sehr<br />
kleiner Gasvolumengehalte a < 0,1 % - größer ist als<br />
die zu dem betreffenden Gasvolumengehalt zugehörige<br />
Schallgeschwindigkeit. Mit wachsendem Berstdruckverhältnis<br />
.!:I n<strong>im</strong>mt die Stoßwellengeschwindigkeit<br />
zu. Dage~lm<br />
n<strong>im</strong>mt sie mit wachsendem Gasvolumengehalt<br />
in dem betrachteten Bereich °%< a<br />
> 15 %stetig ab.<br />
Wird der Gasvolumengehalt auf Werte herabgesetzt,<br />
die unterhalb etwa 3 % liegen, so wird das Ausbreitungsverhalten<br />
der Wellen mit abnehmendem a-Wert<br />
in <strong>im</strong>mer stärkerem Maße durch die vergleichsweise<br />
große Verformbarkeit der Rohrwand beeinflußt, die<br />
bedingt ist durch den relativ kleinen Elastizitätsmodul<br />
des Werkstoffes Plexiglas.<br />
Um diesen Einfluß zu verringern <strong>und</strong> um höhere Temperaturen<br />
zu ermöglichen, wurde eine neue, beheizbare<br />
Stoßrohranlage aus Glas mit der Nennweite<br />
100 mm aufgebaut. Es stehen Rohrschüsse verschiedener<br />
Länge zur Verfügung, die eine weitgehend flexible<br />
Versuchsdurchführung gewährleisten. Mit dieser<br />
Anlage wird die Fortpflanzung schwacher Kompressions-<br />
<strong>und</strong> Expansionswellen <strong>im</strong> System Wasserdampf<br />
/Wasser bei Umgebungsdruck untersucht. In vorausgegangenen<br />
Vorversuchen mit Glasrohren von kleineren<br />
Längen <strong>und</strong> unterschiedlichen Durchmessern konnte<br />
nachgewiesen werden, daß es möglich ist, ausreichend<br />
homogene <strong>und</strong> stabile Blasengemische über die gesamte<br />
Rohrlänge aufrechtzuerhalten.<br />
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Reaktortechnik<br />
der Universität Karlsruhe (TH) wurde das Siedeverhalten<br />
von Wasser an technisch rauhen Heizflächen<br />
näher untersucht (4015). Hierzu wurden als Heizflächen<br />
zylindrische, elektrisch beheizte Stäbe von<br />
1°mm Durchmesser <strong>und</strong> ca. 60 mm beheizter Länge<br />
verwendet. Die Oberflächen der Heizstäbe aus Werkstoff<br />
Nr. 4541 waren verschieden bearbeitet. Es wurde<br />
je ein Stab mit gefeilter, polierter, geläppter <strong>und</strong><br />
sandgestrahlter Oberfläche untersucht. Die Heizer<br />
wurden in vertikaler <strong>und</strong> horizontaler Lage getestet.<br />
Als Flüssigkeit diente destilliertes Wasser. Alle Ver-<br />
132












![{A1[]Sp - Bibliothek](https://img.yumpu.com/21908054/1/184x260/a1sp-bibliothek.jpg?quality=85)