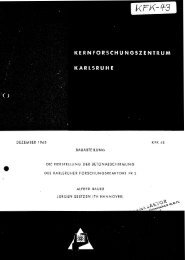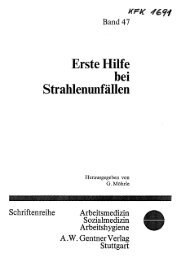bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3/68/8 Studien zu einem Hochenergie-Protonensynchrotron<br />
Im Rahmen der Studien zu einem Hochenergieprotonensynchrotron<br />
wurden <strong>im</strong> )ahre 1970 schwerpunktsmäßig<br />
Arbeiten zur Entwicklung von Tieftemperaturmagneten<br />
durchgeführt. Diese Untersuchungen bezogen<br />
sich auf Material- <strong>und</strong> Model/untersuchungen für<br />
Magnete mit Spulen aus Supraleitern <strong>und</strong> hochgereinigtem<br />
Aluminium <strong>und</strong> für dazugehörige kryotechnische<br />
Anlagen. Eine automatisierte Magnetfeld-Meßeinrichtung<br />
wurde in Betrieb genommen. Theoretische<br />
Untersuchungen von Synchrotronkomponenten<br />
wurden <strong>im</strong> Zusammenhang mit der Planung der europäischen<br />
300 GeV-Masch ine durchgeführt.<br />
Zusammenarbeit mit CERN <strong>und</strong> theoretische<br />
Untersuchungen<br />
Obwohl sich die Beschleunigerstudiengruppe Karlsruhe<br />
weiterhin als federführend für das Projekt eines<br />
Hochenergie-Protonensynchrotrons (z. B. 60 GeV)<br />
betrachtet, wurden die Arbeiten daran zunächst eingestellt,<br />
bis eine endgliltige Klärung der Möglichkeiten<br />
zum Bau gegeben ist. Die während der abgeschlossenen<br />
Studien gewonnenen Erkenntnisse wurden in<br />
zwei Richtungen eingesetzt:<br />
1. bei der Mitarbeit am Entwurf eines großen europäischen<br />
Synchrotrons (CERN 11) <strong>und</strong><br />
2. bei überlegungen zur Auslegung eines kleinen Beschleunigers,<br />
mit dem die Zuverlässigkeit von Tieftemperaturmagneten<br />
untersucht werden kann.<br />
Be<strong>im</strong> Entwurf des europäischen Beschleunigers trat<br />
eine neue Situation ein, wei I ein neuer Standort neben<br />
dem bereits existierenden CERN-Protonensynchrotron<br />
ins Auge gefaßt wurde. Um einen für diesen<br />
Standort geeigneten <strong>und</strong> möglichst opt<strong>im</strong>alen Vorschlag<br />
vorzulegen, wurden in CERN insgesamt 14 Arbeitsgruppen<br />
gebildet, in denen Einzelaspekte untersucht<br />
wurden. Die Arbeitsgruppen setzten sich aus<br />
Mitarbeitern des CERN <strong>und</strong> anderer westeuropäischer<br />
Beschleunigerzentren zusammen.<br />
Die Arbeiten dieser Gruppen wurden <strong>im</strong> sogenannten<br />
Maschinen-Komitee koordiniert, das schließlich eine<br />
Gesamtkonzeption für den Beschleuniger erarbeitet<br />
<strong>und</strong> den entscheidenden Gremien einen detail/ierten<br />
baureifen Vorschlag vorgelegt hat. Die Beschleunigergruppe<br />
Karlsruhe ist <strong>im</strong> Maschinen-Komitee <strong>und</strong> vier<br />
Arbeitsgruppen vertreten (Struktur des Magnetsystems,<br />
Magnete, Ejektion, Auslegung der Exper<strong>im</strong>entierflächen).<br />
Die Aufgabenstel/ungen werden <strong>im</strong> folgenden<br />
erwähnt <strong>und</strong> die Karlsruher Beiträge beschrieben.<br />
In der CERN-Arbeitsgruppe Struktur wurden mehrere<br />
alternative Strukturen miteinander verglichen. Als we-<br />
sentliche Entscheidungskriterien dienten die Gesamtkosten<br />
sowie eine Abwägung der konkurrierenden<br />
Erfordernisse von Ejektion <strong>und</strong> Injektion (bzw. Hochfrequenz).<br />
In der opt<strong>im</strong>alen Struktur ist <strong>im</strong> Gegensatz<br />
zu den bisherigen Vorschlägen die horizontale Ausdehnung<br />
der Magnetapertur nicht durch die Strahleigenschaften<br />
bei der Injektion, sondern bei der Transitions-Energie<br />
gegeben. Das beruht <strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>e auf<br />
der Verwendung des existierenden CERN-PS als Injektor,<br />
dessen Hochfrequenzsystem nicht opt<strong>im</strong>al an<br />
die Erfordernisse der größeren Maschine angepaßt ist.<br />
Um die Aperturanforderungen bei der Transitions<br />
Energie möglichst zu reduzieren, wurden Rechnungen<br />
zur Verkleinerung der Amplitude der Dispersionsbahn<br />
der Teilchen durchgeflihrt (4244).<br />
Für die Arbeiten in der Arbeitsgruppe Magnete wurden<br />
Beiträge flir den Entwurf der Magnete geliefert,<br />
deren Länge, Feldstärke, Feldform <strong>und</strong> Apertur von<br />
der Struktur des Beschleunigers vorgegeben sind. Um<br />
einen Vergleich zwischen Biegemagnettypen mit <strong>und</strong><br />
ohne Leiter in der Mittelebene zu ermöglichen, wurde<br />
der Einfluß von Lagefehlern der Spule auf die Feldgüte<br />
<strong>im</strong> Magneten berechnet. Außerdem wurden mit<br />
Computerprogrammen, die die magnetischen Eigenschaften<br />
von Eisen berlicksichtigen, insgesamt 7 verschiedene<br />
Quadrupole berechnet (4245); dadurch<br />
wird die Auswahl eines opt<strong>im</strong>alen Typs ermöglicht,<br />
wobei ebenso wie bei den Biegemagneten Spulen<br />
innerhalb oder außerhalb der Mittelebene betrachtet<br />
werden.<br />
In der Arbeitsgruppe Ejektion wurde für das vorgeschlagene<br />
Schema der langsamen Ejektion der Einfluß<br />
von Nichtlinearitäten in Biegemagneten <strong>und</strong> Quadrupolen<br />
auf den Extraktionsprozeß mit Hilfe eines<br />
Strahl-Verfolgungsprogramms untersucht. Die Toleranzgrenzen<br />
flir die Fehler (Abb.7) (etwa 10- 3 am<br />
Rande der Apertur) konnten damit best<strong>im</strong>mt werden<br />
(4246, 4247). Neben diesen anwendungsorientierten<br />
Berechnungen wUrden die Studien der Eigenschaften<br />
einfacher nichtlinearer periodischer Transformationen<br />
fortgesetzt. Dabei wurde ausgiebig von der Möglichkeit<br />
Gebrauch gemacht, von den Rechnern IBM<br />
360/65 <strong>und</strong> 360/91 mittels des FORMAC-Systems<br />
auch algebraische Manipulationen ausführen zu lassen.<br />
In der CERN-Arbeitsgruppe zur Auslegung der Exper<strong>im</strong>entierflächen<br />
wurden vor al/em die Möglichkeiten<br />
untersucht, eine bereits existierende Halle flir die<br />
Exper<strong>im</strong>ente der ersten Ausbaustufe von CE RN 11 zu<br />
benutzen. Es ergab sich, daß Strahlführungen für Pr i<br />
mär<strong>im</strong>pulse bis zu 200 GeV/c aufgebaut werden<br />
können. Die von Karlsruhe gelieferten Beiträge bezogen<br />
sich auf die Auslegung des Strahlführungskanals<br />
vom Beschleuniger zu dieser Hal/e <strong>und</strong> auf den Aufbau<br />
eines Sek<strong>und</strong>ärstrahls von 75 GeV/c (4249).<br />
Außerdem wurden die wesentlichen Strahlflihrungsmagnete<br />
standardisiert <strong>und</strong> kostenmäßig opt<strong>im</strong>iert<br />
50












![{A1[]Sp - Bibliothek](https://img.yumpu.com/21908054/1/184x260/a1sp-bibliothek.jpg?quality=85)