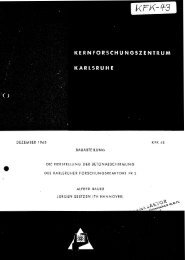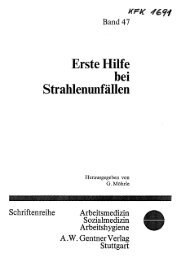bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
bericht forschungs· und entwicklungsarbeiten im jahre ... - Bibliothek
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auch in dieser Anordnung lief der Siedevorgang meist<br />
heftig pulsierend ab. Die dabei erzeugten Druckstöße<br />
reichten jedoch nicht aus, um das Natrium gegen den<br />
Druck der Drossel nach unten aus der Teststrecke<br />
herauszudrücken, so daß die Dampfblasen nach oben<br />
herausgeschwemmt wurden. Zeitweise kam es auch<br />
zur Ausbildung einer stabilen Zweiphasenströmung.<br />
In beiden Fällen, sowohl be<strong>im</strong> pulsierenden als auch<br />
be<strong>im</strong> stabilen Sieden, zeigte der an der Teststrecke<br />
gemessene Druckverlust den für die Zweiphasenströmung<br />
typischen Anstieg bei abnehmendem<br />
Kühlmitteldurchsatz. Wenn der Gesamtdruckverlust<br />
von Teststrecke <strong>und</strong> Drossel ein Min<strong>im</strong>um erreicht,<br />
kommt es zu einer weiteren starken Reduktion des<br />
Kühlmitteldurchsatzes <strong>und</strong> damit zu einer Unterbrechung<br />
der Teststreckenkühlung.<br />
Im Berichtsjahr 1970 wurden die Montage <strong>und</strong> die<br />
Inbetriebnahmetests der Versuchsapparatur BEVUS<br />
abgeschlossen <strong>und</strong> die ersten Versuche durchgefUhrt.<br />
Auf dem BEVUS-Versuchsstand werden Siedeexper<strong>im</strong>ente<br />
in einem elektrisch beheizten Brennelement<br />
Modell, das von sechs unbeheizten Brennelementattrappen<br />
umgeben ist, durchgeführt. Diese Exper<strong>im</strong>ente<br />
dienen dem Nachweis, daß durch Siede- <strong>und</strong><br />
Rekondensationsdruckstöße keine gefährlichen Verformungen<br />
an dem betroffenen Brennelement <strong>und</strong><br />
den Nachbarelementen verursacht werden. Der Siedeverzug<br />
<strong>und</strong> damit die Höhe der auftretenden Siededruckstöße<br />
werden dadurch variiert, daß das Natrium<br />
unter erhöhtem Druck aufgeheizt wird <strong>und</strong> nach Erreichen<br />
der gewünschten überhitzungstemperatur der<br />
Siedevorgang durch eine rasche definierte Druckwegnahme<br />
ausgelöst wird.<br />
In den Monaten Oktober bis Dezember wurden 11<br />
Siedeexper<strong>im</strong>ente durchgeführt. Bei den ersten vier<br />
wurde die überhitzungstemperatur durch Druckhaltung<br />
festgelegt, in sieben weiteren Exper<strong>im</strong>enten<br />
wurde untersucht, welche überhitzungstemperaturen<br />
erreichbar sind, wenn die überhitzung nicht erzwungen<br />
wird. Die Meßdaten wurden mit Hilfe einer elektronischen<br />
Datenerfassungsanlage auf Magnetband<br />
aufgezeich net.<br />
Die Auswertung der Versuchsergebnisse ist noch nicht<br />
abgeschlossen. Es zeichnet sich folgendes ab:<br />
Bei Siedeverzug erreichte der Druckstoß bei Beginn<br />
des Siedens Max<strong>im</strong>alwerte, die etwa mit den<br />
Werten des Dampfdruckes (bei der höchsten erreichten<br />
Temperatur) übereinst<strong>im</strong>mten.<br />
Das in das Element zurückfallende Natrium verursachte<br />
eine abkl ingende Druckschwingung, deren<br />
Max<strong>im</strong>alausschlag oberhalb des Stabbündels gemessen<br />
ca. 1 at betrug.<br />
Ohne Zwang durch Druckaufgabe wurden Siedeverzüge<br />
bis zu 40° C gemessen.<br />
Der Brennelementkasten ist noch nicht <strong>im</strong> Hinblick<br />
auf eine evtl. Verformung vermessen worden. Dies<br />
kann erst nach Demontage des Versuchsaufbaues erfolgen.<br />
Ein 2. Versuchselement wird z. Z. angefertigt. Mit<br />
ihm sollen die bereits vorliegenden Versuchsergebnisse<br />
bestätigt werden.<br />
Auf theoretischer Seite wurden umfangreiche Testrechnungen<br />
mit dem Rechen-Code BLOW durchgeführt,<br />
der zur Beschreibung der Siedevorgänge bei integralen<br />
Kühlungsstörungen in einem Brennelement<br />
entwickelt wurde, <strong>und</strong> die Rechnungen mit den Ergebnissen<br />
der beschriebenen Na-Siedeversuche verglichen.<br />
Daraus resultierten gewisse Verbesserungen<br />
am BLOW 2, die eine genauere Berechnung der Temperaturen<br />
<strong>im</strong> Brennstoff, Cladding <strong>und</strong> Kühlmittel erlauben<br />
<strong>und</strong> die Temperaturabhängigkeit der Dichte<br />
<strong>und</strong> spez. Wärme des Kühlmittels berücksichtigen. Andere<br />
Beschränkungen von BLOW 2 sind eng mit dem<br />
gewählten Modell verknüpft <strong>und</strong> sollen noch näher<br />
untersucht werden.<br />
Von der UKAEA wurde in Kar/sruhe eine Serie von<br />
Rechnungen mit BLOW 2 fUr PFR-Bedingungen gemacht.<br />
Die genaue Auswertung der Ergebnisse erfolgte<br />
in England.<br />
Siedeverzug<br />
(4013,3946,3951,3957,3961,3975)<br />
Eine genauere Kenntnis des Siedeverzuges von Natrium<br />
ist <strong>im</strong> Rahmen von Sicherheitsuntersuchungen für<br />
schnelle natriumgekühlte Reaktoren bei der Behandlung<br />
verschiedener Unfallsituationen erwünscht, die<br />
aus Kühlungsstörungen entstehen können. Dazu wurde<br />
ein Versuchsprogramm in einer Behältersiedeanordnung<br />
durchgeführt (4013). Die Apparatur besteht<br />
aus einem Testbehälter mit angeschlossenem Naturkonvektionskreislauf,<br />
der Schutzgasversorgung, dem<br />
Heizungssystem sowie den erforderlichen Meß- <strong>und</strong><br />
Rege/einrichtungen. Die Versuchsparameter sind: das<br />
Testflächenmaterial, die Geometrie einer künstlichen<br />
Höhlung sowie die Natriumoxidkonzentration.<br />
Der Einfluß von gelöstem Argon wurde in drei Versuchsserien<br />
untersucht. Danach wurden diese Versuche<br />
abgebrochen, da die Ergebnisse unsystematisch<br />
<strong>im</strong> Streubereich der Werte ohne Argon liegen. Alle<br />
anderen Exper<strong>im</strong>ente wurden mit sorgfältig entgastem<br />
Natrium ohne Schutzgasdruck durchgeführt.<br />
Als Testflächenmaterialien wurden untersucht:<br />
rostfreier Stahl Werkstoff Nr. 4541 X 10 CrNiTi<br />
189; Werkstoff Nr. 4571 X 10 CrNiMoTi 18 10<br />
<strong>und</strong> in besonderen Testflächen<br />
reines Nickel, Eisen <strong>und</strong> Chrom.<br />
Die Geometrie der künstlichen Höhlungen - zylindrische<br />
Bohrungen - wurde in der Tiefe H <strong>und</strong> dem<br />
Durchmesser D variiert. Die Natriumoxidkonzen-<br />
124












![{A1[]Sp - Bibliothek](https://img.yumpu.com/21908054/1/184x260/a1sp-bibliothek.jpg?quality=85)