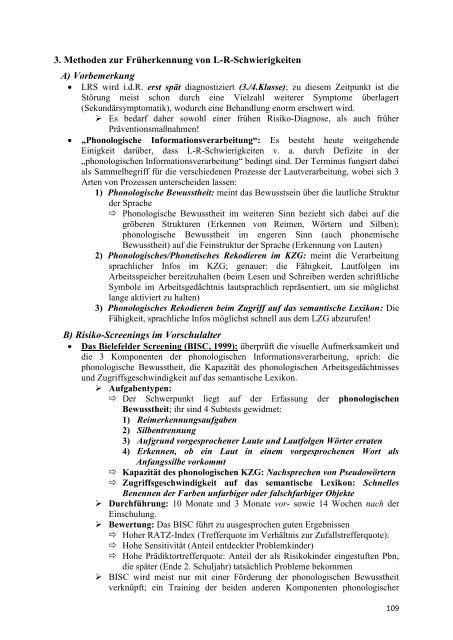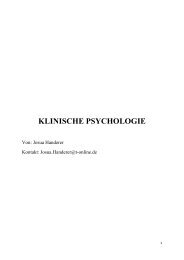A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Methoden zur Früherkennung von L-R-Schwierigkeiten<br />
A) Vorbemerkung<br />
� LRS wird i.d.R. erst spät diagnostiziert (3./4.Klasse); zu diesem Zeitpunkt ist die<br />
Störung meist schon durch eine Vielzahl weiterer Symptome überlagert<br />
(Sekundärsymptomatik), wodurch eine Behandlung enorm erschwert wird.<br />
� Es bedarf daher sowohl einer frühen Risiko-Diagnose, als auch früher<br />
Präventionsmaßnahmen!<br />
� „Phonologische Informationsverarbeitung“: Es besteht heute weitgehende<br />
Einigkeit darüber, dass L-R-Schwierigkeiten v. a. durch Defizite in der<br />
„phonologischen Informationsverarbeitung“ bedingt sind. Der Terminus fungiert dabei<br />
als Sammelbegriff für die verschiedenen Prozesse der Lautverarbeitung, wobei sich 3<br />
Arten von Prozessen unterscheiden lassen:<br />
1) Phonologische Bewusstheit: meint das Bewusstsein über die lautliche Struktur<br />
der Sprache<br />
� Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn bezieht sich dabei auf die<br />
gröberen Strukturen (Erkennen von Reimen, Wörtern und Silben);<br />
phonologische Bewusstheit im engeren Sinn (auch phonemische<br />
Bewusstheit) auf die Feinstruktur der Sprache (Erkennung von Lauten)<br />
2) Phonologisches/Phonetisches Rekodieren im KZG: meint die Verarbeitung<br />
sprachlicher Infos im KZG; genauer: die Fähigkeit, Lautfolgen im<br />
Arbeitsspeicher bereitzuhalten (beim Lesen und Schreiben werden schriftliche<br />
Symbole im Arbeitsgedächtnis lautsprachlich repräsentiert, um sie möglichst<br />
lange aktiviert zu halten)<br />
3) Phonologisches Rekodieren beim Zugriff auf das semantische Lexikon: Die<br />
Fähigkeit, sprachliche Infos möglichst schnell aus dem LZG abzurufen!<br />
B) Risiko-Screenings im Vorschulalter<br />
� Das Bielefelder Screening (BISC, 1999): überprüft die visuelle Aufmerksamkeit und<br />
die 3 Komponenten der phonologischen Informationsverarbeitung, sprich: die<br />
phonologische Bewusstheit, die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses<br />
und Zugriffsgeschwindigkeit auf das semantische Lexikon.<br />
� Aufgabentypen:<br />
� Der Schwerpunkt liegt auf der Erfassung der phonologischen<br />
Bewusstheit; ihr sind 4 Subtests gewidmet:<br />
1) Reimerkennungsaufgaben<br />
2) Silbentrennung<br />
3) Aufgrund vorgesprochener Laute und Lautfolgen Wörter erraten<br />
4) Erkennen, ob ein Laut in einem vorgesprochenen Wort als<br />
Anfangssilbe vorkommt<br />
� Kapazität des phonologischen KZG: Nachsprechen von Pseudowörtern<br />
� Zugriffsgeschwindigkeit auf das semantische Lexikon: Schnelles<br />
Benennen der Farben unfarbiger oder falschfarbiger Objekte<br />
� Durchführung: 10 Monate und 3 Monate vor- sowie 14 Wochen nach der<br />
Einschulung.<br />
� Bewertung: Das BISC führt zu ausgesprochen guten Ergebnissen<br />
� Hoher RATZ-Index (Trefferquote im Verhältnis zur Zufallstrefferquote):<br />
� Hohe Sensitivität (Anteil entdeckter Problemkinder)<br />
� Hohe Prädiktortrefferquote: Anteil der als Risikokinder eingestuften Pbn,<br />
die später (Ende 2. Schuljahr) tatsächlich Probleme bekommen<br />
� BISC wird meist nur mit einer Förderung der phonologischen Bewusstheit<br />
verknüpft; ein Training der beiden anderen Komponenten phonologischer<br />
109