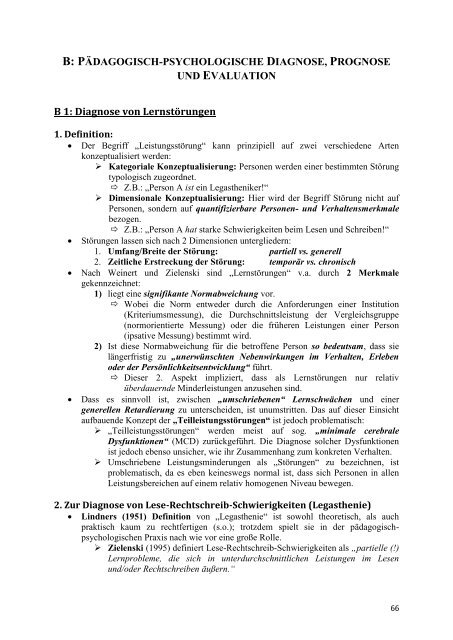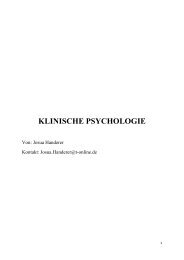A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
B: PÄDAGOGISCH-PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSE, PROGNOSE<br />
<strong>UND</strong> EVALUATION<br />
B 1: Diagnose von Lernstörungen<br />
1. Definition:<br />
� Der Begriff „Leistungsstörung“ kann prinzipiell auf zwei verschiedene Arten<br />
konzeptualisiert werden:<br />
� Kategoriale Konzeptualisierung: Personen werden einer bestimmten Störung<br />
typologisch zugeordnet.<br />
� Z.B.: „Person A ist ein Legastheniker!“<br />
� Dimensionale Konzeptualisierung: Hier wird der Begriff Störung nicht auf<br />
Personen, sondern auf quantifizierbare Personen- und Verhaltensmerkmale<br />
bezogen.<br />
� Z.B.: „Person A hat starke Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben!“<br />
� Störungen lassen sich nach 2 Dimensionen untergliedern:<br />
1. Umfang/Breite der Störung: partiell vs. generell<br />
2. Zeitliche Erstreckung der Störung: temporär vs. chronisch<br />
� Nach Weinert und Zielenski sind „Lernstörungen“ v.a. durch 2 Merkmale<br />
gekennzeichnet:<br />
1) liegt eine signifikante Normabweichung vor.<br />
� Wobei die Norm entweder durch die Anforderungen einer Institution<br />
(Kriteriumsmessung), die Durchschnittsleistung der Vergleichsgruppe<br />
(normorientierte Messung) oder die früheren Leistungen einer Person<br />
(ipsative Messung) bestimmt wird.<br />
2) Ist diese Normabweichung für die betroffene Person so bedeutsam, dass sie<br />
längerfristig zu „unerwünschten Nebenwirkungen im Verhalten, Erleben<br />
oder der Persönlichkeitsentwicklung“ führt.<br />
� Dieser 2. Aspekt impliziert, dass als Lernstörungen nur relativ<br />
überdauernde Minderleistungen anzusehen sind.<br />
� Dass es sinnvoll ist, zwischen „umschriebenen“ Lernschwächen und einer<br />
generellen Retardierung zu unterscheiden, ist unumstritten. Das auf dieser Einsicht<br />
aufbauende Konzept der „Teilleistungsstörungen“ ist jedoch problematisch:<br />
� „Teilleistungsstörungen“ werden meist auf sog. „minimale cerebrale<br />
Dysfunktionen“ (MCD) zurückgeführt. Die Diagnose solcher Dysfunktionen<br />
ist jedoch ebenso unsicher, wie ihr Zusammenhang zum konkreten Verhalten.<br />
� Umschriebene Leistungsminderungen als „Störungen“ zu bezeichnen, ist<br />
problematisch, da es eben keineswegs normal ist, dass sich Personen in allen<br />
Leistungsbereichen auf einem relativ homogenen Niveau bewegen.<br />
2. Zur Diagnose von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (Legasthenie)<br />
� Lindners (1951) Definition von „Legasthenie“ ist sowohl theoretisch, als auch<br />
praktisch kaum zu rechtfertigen (s.o.); trotzdem spielt sie in der pädagogischpsychologischen<br />
Praxis nach wie vor eine große Rolle.<br />
� Zielenski (1995) definiert Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten als „partielle (!)<br />
Lernprobleme, die sich in unterdurchschnittlichen Leistungen im Lesen<br />
und/oder Rechtschreiben äußern.“<br />
66