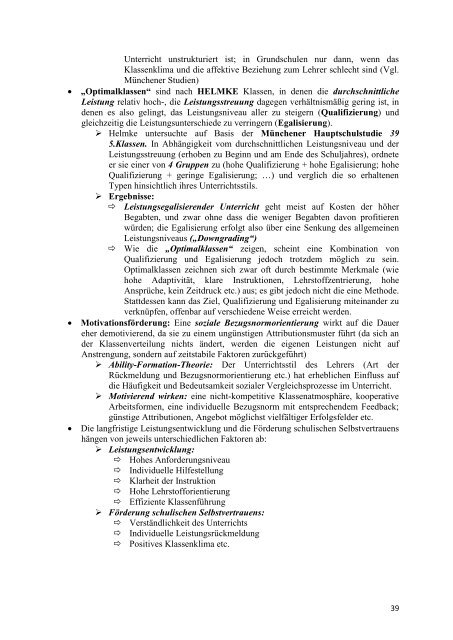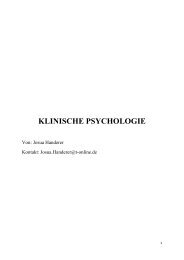A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Unterricht unstrukturiert ist; in Grundschulen nur dann, wenn das<br />
Klassenklima und die affektive Beziehung zum Lehrer schlecht sind (Vgl.<br />
Münchener Studien)<br />
� „Optimalklassen“ sind nach HELMKE Klassen, in denen die durchschnittliche<br />
Leistung relativ hoch-, die Leistungsstreuung dagegen verhältnismäßig gering ist, in<br />
denen es also gelingt, das Leistungsniveau aller zu steigern (Qualifizierung) und<br />
gleichzeitig die Leistungsunterschiede zu verringern (Egalisierung).<br />
� Helmke untersuchte auf Basis der Münchener Hauptschulstudie 39<br />
5.Klassen. In Abhängigkeit vom durchschnittlichen Leistungsniveau und der<br />
Leistungsstreuung (erhoben zu Beginn und am Ende des Schuljahres), ordnete<br />
er sie einer von 4 Gruppen zu (hohe Qualifizierung + hohe Egalisierung; hohe<br />
Qualifizierung + geringe Egalisierung; …) und verglich die so erhaltenen<br />
Typen hinsichtlich ihres Unterrichtsstils.<br />
� Ergebnisse:<br />
� Leistungsegalisierender Unterricht geht meist auf Kosten der höher<br />
Begabten, und zwar ohne dass die weniger Begabten davon profitieren<br />
würden; die Egalisierung erfolgt also über eine Senkung des allgemeinen<br />
Leistungsniveaus („Downgrading“)<br />
� Wie die „Optimalklassen“ zeigen, scheint eine Kombination von<br />
Qualifizierung und Egalisierung jedoch trotzdem möglich zu sein.<br />
Optimalklassen zeichnen sich zwar oft durch bestimmte Merkmale (wie<br />
hohe Adaptivität, klare Instruktionen, Lehrstoffzentrierung, hohe<br />
Ansprüche, kein Zeitdruck etc.) aus; es gibt jedoch nicht die eine Methode.<br />
Stattdessen kann das Ziel, Qualifizierung und Egalisierung miteinander zu<br />
verknüpfen, offenbar auf verschiedene Weise erreicht werden.<br />
� Motivationsförderung: Eine soziale Bezugsnormorientierung wirkt auf die Dauer<br />
eher demotivierend, da sie zu einem ungünstigen Attributionsmuster führt (da sich an<br />
der Klassenverteilung nichts ändert, werden die eigenen Leistungen nicht auf<br />
Anstrengung, sondern auf zeitstabile Faktoren zurückgeführt)<br />
� Ability-Formation-Theorie: Der Unterrichtsstil des Lehrers (Art der<br />
Rückmeldung und Bezugsnormorientierung etc.) hat erheblichen Einfluss auf<br />
die Häufigkeit und Bedeutsamkeit sozialer Vergleichsprozesse im Unterricht.<br />
� Motivierend wirken: eine nicht-kompetitive Klassenatmosphäre, kooperative<br />
Arbeitsformen, eine individuelle Bezugsnorm mit entsprechendem Feedback;<br />
günstige Attributionen, Angebot möglichst vielfältiger Erfolgsfelder etc.<br />
� Die langfristige Leistungsentwicklung und die Förderung schulischen Selbstvertrauens<br />
hängen von jeweils unterschiedlichen Faktoren ab:<br />
� Leistungsentwicklung:<br />
� Hohes Anforderungsniveau<br />
� Individuelle Hilfestellung<br />
� Klarheit der Instruktion<br />
� Hohe Lehrstofforientierung<br />
� Effiziente Klassenführung<br />
� Förderung schulischen Selbstvertrauens:<br />
� Verständlichkeit des Unterrichts<br />
� Individuelle Leistungsrückmeldung<br />
� Positives Klassenklima etc.<br />
39