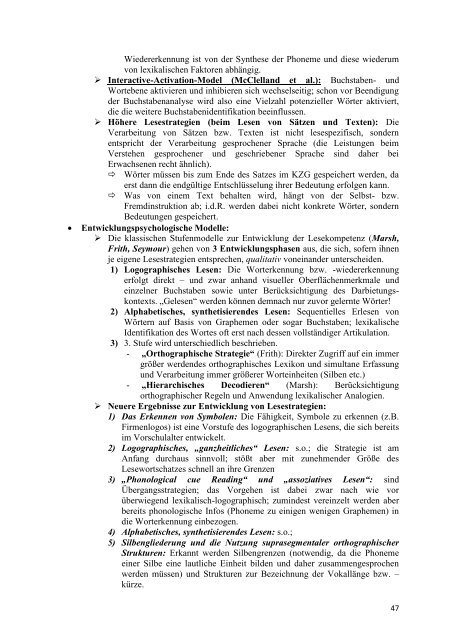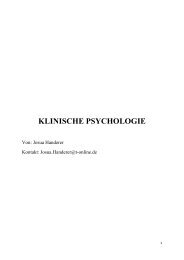A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wiedererkennung ist von der Synthese der Phoneme und diese wiederum<br />
von lexikalischen Faktoren abhängig.<br />
� Interactive-Activation-Model (McClelland et al.): Buchstaben- und<br />
Wortebene aktivieren und inhibieren sich wechselseitig; schon vor Beendigung<br />
der Buchstabenanalyse wird also eine Vielzahl potenzieller Wörter aktiviert,<br />
die die weitere Buchstabenidentifikation beeinflussen.<br />
� Höhere Lesestrategien (beim Lesen von Sätzen und Texten): Die<br />
Verarbeitung von Sätzen bzw. Texten ist nicht lesespezifisch, sondern<br />
entspricht der Verarbeitung gesprochener Sprache (die Leistungen beim<br />
Verstehen gesprochener und geschriebener Sprache sind daher bei<br />
Erwachsenen recht ähnlich).<br />
� Wörter müssen bis zum Ende des Satzes im KZG gespeichert werden, da<br />
erst dann die endgültige Entschlüsselung ihrer Bedeutung erfolgen kann.<br />
� Was von einem Text behalten wird, hängt von der Selbst- bzw.<br />
Fremdinstruktion ab; i.d.R. werden dabei nicht konkrete Wörter, sondern<br />
Bedeutungen gespeichert.<br />
� Entwicklungspsychologische Modelle:<br />
� Die klassischen Stufenmodelle zur Entwicklung der Lesekompetenz (Marsh,<br />
Frith, Seymour) gehen von 3 Entwicklungsphasen aus, die sich, sofern ihnen<br />
je eigene Lesestrategien entsprechen, qualitativ voneinander unterscheiden.<br />
1) Logographisches Lesen: Die Worterkennung bzw. -wiedererkennung<br />
erfolgt direkt – und zwar anhand visueller Oberflächenmerkmale und<br />
einzelner Buchstaben sowie unter Berücksichtigung des Darbietungskontexts.<br />
„Gelesen“ werden können demnach nur zuvor gelernte Wörter!<br />
2) Alphabetisches, synthetisierendes Lesen: Sequentielles Erlesen von<br />
Wörtern auf Basis von Graphemen oder sogar Buchstaben; lexikalische<br />
Identifikation des Wortes oft erst nach dessen vollständiger Artikulation.<br />
3) 3. Stufe wird unterschiedlich beschrieben.<br />
- „Orthographische Strategie“ (Frith): Direkter Zugriff auf ein immer<br />
größer werdendes orthographisches Lexikon und simultane Erfassung<br />
und Verarbeitung immer größerer Worteinheiten (Silben etc.)<br />
- „Hierarchisches Decodieren“ (Marsh): Berücksichtigung<br />
orthographischer Regeln und Anwendung lexikalischer Analogien.<br />
� Neuere Ergebnisse zur Entwicklung von Lesestrategien:<br />
1) Das Erkennen von Symbolen: Die Fähigkeit, Symbole zu erkennen (z.B.<br />
Firmenlogos) ist eine Vorstufe des logographischen Lesens, die sich bereits<br />
im Vorschulalter entwickelt.<br />
2) Logographisches, „ganzheitliches“ Lesen: s.o.; die Strategie ist am<br />
Anfang durchaus sinnvoll; stößt aber mit zunehmender Größe des<br />
Lesewortschatzes schnell an ihre Grenzen<br />
3) „Phonological cue Reading“ und „assoziatives Lesen“: sind<br />
Übergangsstrategien; das Vorgehen ist dabei zwar nach wie vor<br />
überwiegend lexikalisch-logographisch; zumindest vereinzelt werden aber<br />
bereits phonologische Infos (Phoneme zu einigen wenigen Graphemen) in<br />
die Worterkennung einbezogen.<br />
4) Alphabetisches, synthetisierendes Lesen: s.o.;<br />
5) Silbengliederung und die Nutzung suprasegmentaler orthographischer<br />
Strukturen: Erkannt werden Silbengrenzen (notwendig, da die Phoneme<br />
einer Silbe eine lautliche Einheit bilden und daher zusammengesprochen<br />
werden müssen) und Strukturen zur Bezeichnung der Vokallänge bzw. –<br />
kürze.<br />
47