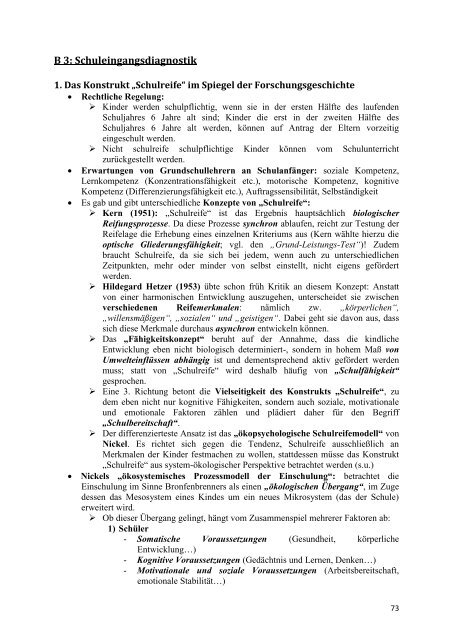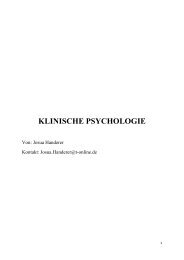A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
B 3: Schuleingangsdiagnostik<br />
1. Das Konstrukt „Schulreife“ im Spiegel der Forschungsgeschichte<br />
� Rechtliche Regelung:<br />
� Kinder werden schulpflichtig, wenn sie in der ersten Hälfte des laufenden<br />
Schuljahres 6 Jahre alt sind; Kinder die erst in der zweiten Hälfte des<br />
Schuljahres 6 Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern vorzeitig<br />
eingeschult werden.<br />
� Nicht schulreife schulpflichtige Kinder können vom Schulunterricht<br />
zurückgestellt werden.<br />
� Erwartungen von Grundschullehrern an Schulanfänger: soziale Kompetenz,<br />
Lernkompetenz (Konzentrationsfähigkeit etc.), motorische Kompetenz, kognitive<br />
Kompetenz (Differenzierungsfähigkeit etc.), Auftragssensibilität, Selbständigkeit<br />
� Es gab und gibt unterschiedliche Konzepte von „Schulreife“:<br />
� Kern (1951): „Schulreife“ ist das Ergebnis hauptsächlich biologischer<br />
Reifungsprozesse. Da diese Prozesse synchron ablaufen, reicht zur Testung der<br />
Reifelage die Erhebung eines einzelnen Kriteriums aus (Kern wählte hierzu die<br />
optische Gliederungsfähigkeit; vgl. den „Grund-Leistungs-Test“)! Zudem<br />
braucht Schulreife, da sie sich bei jedem, wenn auch zu unterschiedlichen<br />
Zeitpunkten, mehr oder minder von selbst einstellt, nicht eigens gefördert<br />
werden.<br />
� Hildegard Hetzer (1953) übte schon früh Kritik an diesem Konzept: Anstatt<br />
von einer harmonischen Entwicklung auszugehen, unterscheidet sie zwischen<br />
verschiedenen Reifemerkmalen: nämlich zw. „körperlichen“,<br />
„willensmäßigen“, „sozialen“ und „geistigen“. Dabei geht sie davon aus, dass<br />
sich diese Merkmale durchaus asynchron entwickeln können.<br />
� Das „Fähigkeitskonzept“ beruht auf der Annahme, dass die kindliche<br />
Entwicklung eben nicht biologisch determiniert-, sondern in hohem Maß von<br />
Umwelteinflüssen abhängig ist und dementsprechend aktiv gefördert werden<br />
muss; statt von „Schulreife“ wird deshalb häufig von „Schulfähigkeit“<br />
gesprochen.<br />
� Eine 3. Richtung betont die Vielseitigkeit des Konstrukts „Schulreife“, zu<br />
dem eben nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch soziale, motivationale<br />
und emotionale Faktoren zählen und plädiert daher für den Begriff<br />
„Schulbereitschaft“.<br />
� Der differenzierteste Ansatz ist das „ökopsychologische Schulreifemodell“ von<br />
Nickel. Es richtet sich gegen die Tendenz, Schulreife ausschließlich an<br />
Merkmalen der Kinder festmachen zu wollen, stattdessen müsse das Konstrukt<br />
„Schulreife“ aus system-ökologischer Perspektive betrachtet werden (s.u.)<br />
� Nickels „ökosystemisches Prozessmodell der Einschulung“: betrachtet die<br />
Einschulung im Sinne Bronfenbrenners als einen „ökologischen Übergang“, im Zuge<br />
dessen das Mesosystem eines Kindes um ein neues Mikrosystem (das der Schule)<br />
erweitert wird.<br />
� Ob dieser Übergang gelingt, hängt vom Zusammenspiel mehrerer Faktoren ab:<br />
1) Schüler<br />
- Somatische Voraussetzungen (Gesundheit, körperliche<br />
Entwicklung…)<br />
- Kognitive Voraussetzungen (Gedächtnis und Lernen, Denken…)<br />
- Motivationale und soziale Voraussetzungen (Arbeitsbereitschaft,<br />
emotionale Stabilität…)<br />
73