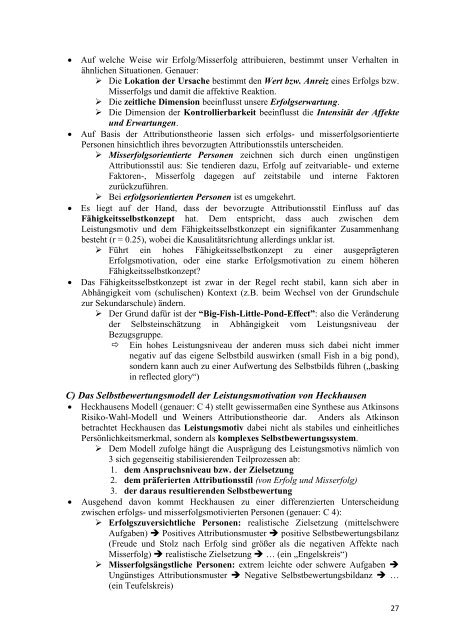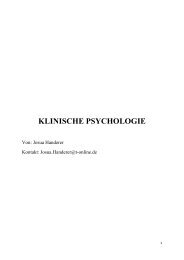A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� Auf welche Weise wir Erfolg/Misserfolg attribuieren, bestimmt unser Verhalten in<br />
ähnlichen Situationen. Genauer:<br />
� Die Lokation der Ursache bestimmt den Wert bzw. Anreiz eines Erfolgs bzw.<br />
Misserfolgs und damit die affektive Reaktion.<br />
� Die zeitliche Dimension beeinflusst unsere Erfolgserwartung.<br />
� Die Dimension der Kontrollierbarkeit beeinflusst die Intensität der Affekte<br />
und Erwartungen.<br />
� Auf Basis der Attributionstheorie lassen sich erfolgs- und misserfolgsorientierte<br />
Personen hinsichtlich ihres bevorzugten Attributionsstils unterscheiden.<br />
� Misserfolgsorientierte Personen zeichnen sich durch einen ungünstigen<br />
Attributionsstil aus: Sie tendieren dazu, Erfolg auf zeitvariable- und externe<br />
Faktoren-, Misserfolg dagegen auf zeitstabile und interne Faktoren<br />
zurückzuführen.<br />
� Bei erfolgsorientierten Personen ist es umgekehrt.<br />
� Es liegt auf der Hand, dass der bevorzugte Attributionsstil Einfluss auf das<br />
Fähigkeitsselbstkonzept hat. Dem entspricht, dass auch zwischen dem<br />
Leistungsmotiv und dem Fähigkeitsselbstkonzept ein signifikanter Zusammenhang<br />
besteht (r = 0.25), wobei die Kausalitätsrichtung allerdings unklar ist.<br />
� Führt ein hohes Fähigkeitsselbstkonzept zu einer ausgeprägteren<br />
Erfolgsmotivation, oder eine starke Erfolgsmotivation zu einem höheren<br />
Fähigkeitsselbstkonzept?<br />
� Das Fähigkeitsselbstkonzept ist zwar in der Regel recht stabil, kann sich aber in<br />
Abhängigkeit vom (schulischen) Kontext (z.B. beim Wechsel von der Grundschule<br />
zur Sekundarschule) ändern.<br />
� Der Grund dafür ist der “Big-Fish-Little-Pond-Effect”: also die Veränderung<br />
der Selbsteinschätzung in Abhängigkeit vom Leistungsniveau der<br />
Bezugsgruppe.<br />
� Ein hohes Leistungsniveau der anderen muss sich dabei nicht immer<br />
negativ auf das eigene Selbstbild auswirken (small Fish in a big pond),<br />
sondern kann auch zu einer Aufwertung des Selbstbilds führen („basking<br />
in reflected glory“)<br />
C) Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Heckhausen<br />
� Heckhausens Modell (genauer: C 4) stellt gewissermaßen eine Synthese aus Atkinsons<br />
Risiko-Wahl-Modell und Weiners Attributionstheorie dar. Anders als Atkinson<br />
betrachtet Heckhausen das Leistungsmotiv dabei nicht als stabiles und einheitliches<br />
Persönlichkeitsmerkmal, sondern als komplexes Selbstbewertungssystem.<br />
� Dem Modell zufolge hängt die Ausprägung des Leistungsmotivs nämlich von<br />
3 sich gegenseitig stabilisierenden Teilprozessen ab:<br />
1. dem Anspruchsniveau bzw. der Zielsetzung<br />
2. dem präferierten Attributionsstil (von Erfolg und Misserfolg)<br />
3. der daraus resultierenden Selbstbewertung<br />
� Ausgehend davon kommt Heckhausen zu einer differenzierten Unterscheidung<br />
zwischen erfolgs- und misserfolgsmotivierten Personen (genauer: C 4):<br />
� Erfolgszuversichtliche Personen: realistische Zielsetzung (mittelschwere<br />
Aufgaben) � Positives Attributionsmuster � positive Selbstbewertungsbilanz<br />
(Freude und Stolz nach Erfolg sind größer als die negativen Affekte nach<br />
Misserfolg) � realistische Zielsetzung � … (ein „Engelskreis“)<br />
� Misserfolgsängstliche Personen: extrem leichte oder schwere Aufgaben �<br />
Ungünstiges Attributionsmuster � Negative Selbstbewertungsbildanz � …<br />
(ein Teufelskreis)<br />
27