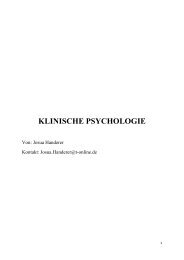A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� Beispiele für Therapiebausteine:<br />
� Elternleidfaden für wirkungsvolle Aufforderungen (gehört zu Stufe 3)<br />
� Regel 1: Stellen sie nur Aufforderungen, wenn sie bereit sind, sie auch<br />
durchzusetzen!<br />
� Regel 2: Verringern sie jegliche Ablenkung, bevor Sie eine Aufforderung<br />
geben!<br />
� Regel 3: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind aufmerksam ist, wenn sie eine<br />
Aufforderung geben!<br />
� Regel 4: Äußern Sie die Aufforderung eindeutig und nicht als Bitte!<br />
� Regel 5: Geben Sie immer nur eine Aufforderung!<br />
� Regel 6: Bitten Sie Ihr Kind, Ihre Aufforderung zu wiederholen!<br />
� Regel 7: Bleiben Sie in unmittelbarer Nähe des Kindes, um sicher zu gehen,<br />
dass Ihr Kind der Aufforderung nachkommt!<br />
� Regel 8: Konzentrieren Sie sich zunächst nur auf wenige Aufforderungen<br />
und protokollieren Sie Ihre Erfahrungen in einem Tagebuch!<br />
� Die kindzentrierten Interventionsmaßnahmen (z.B. Selbstinstruktionstraining)<br />
werden durch Geschichten aus dem Buch „Wackelpeter und Trotzkopf“<br />
eingeleitet, in denen die beiden Figuren von ihren eigenen Erfahrungen mit der<br />
jeweiligen Interventionsmaßnahme berichten und das Kind ermutigen, es auch<br />
mal zu versuchen.<br />
� Mögliche Probleme im Therapieverlauf: Schuldgefühle der Eltern,<br />
Partnerschaftsprobleme der Eltern, zu hoher Erwartungsdruck an die Therapie etc. etc.<br />
� Evaluation: Programm ist vielfach erprobt und hat sich in der Praxis bewährt!<br />
4. Training mit sozial unsicheren Kindern<br />
� Definition: Soziale Unsicherheit ist keine klar definierte Störung; sie weist jedoch<br />
Parallelen zu verschiedenen anderen Störungen auf: etwa zur Trennungsangst,<br />
Überängstlichkeit, sozialer Phobie oder dem elektiven Mutismus (andauernde<br />
Weigerung, in einer oder mehreren sozialen Situationen zu sprechen).<br />
� Sozial unsicheres Verhalten äußert sich sowohl auf verbaler, als auch<br />
nonverbaler Ebene:<br />
� Verbales Verhalten: Betroffene sind eher still, sprechen oft undeutlich oder<br />
stottern und sind oft außer Stande, Gefühle zu äußern etc.<br />
� Nonverbales Verhalten: Betroffene meiden Blickkontakt und soziale<br />
Anforderungssituationen generell, sind im sozialen Kontakt entweder<br />
apathisch oder zappelig etc.<br />
� Sozial unsicheres Verhalten kann dabei personen-, objekt- oder<br />
situationsspezifisch auftreten.<br />
� Epidemologie: Aufgrund der uneinheitlichen Definition sind valide Angaben zur<br />
Epidemologie nur bedingt möglich.<br />
� Sozialphobie.: 0,9%; Trennungsangst: 3,5% etc.<br />
� Schüchterne, zurückgezogene Schüler (nach Lehrerschätzungen): 24-35%<br />
� Ursachen: sind meist ungünstige Lernprozesse<br />
� Modellverhalten der Eltern<br />
� Operantes und klassisches Konditionieren (=> evtl. erlernte Hilflosigkeit)<br />
� Diagnostik: Systematische Verhaltensbeobachtung („Beobachtungsbogen für sozial<br />
unsicheres Verhalten“) + Elternexploration + Ausschluss biologischer Faktoren<br />
(z.B. Seh- und Hörschäden)<br />
� Therapeutischen Vorgehen (typische Interventionsprinzipien und –maßnahmen):<br />
� Modellernen (mit Videos) und Verhaltensübung<br />
126