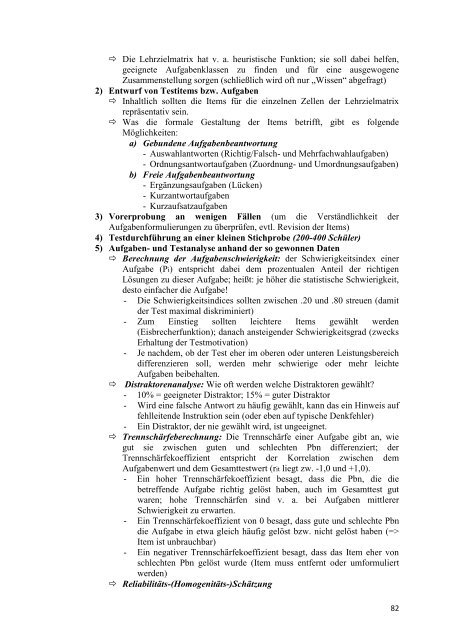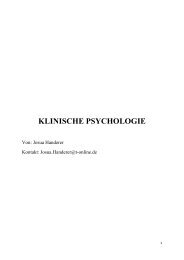A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� Die Lehrzielmatrix hat v. a. heuristische Funktion; sie soll dabei helfen,<br />
geeignete Aufgabenklassen zu finden und für eine ausgewogene<br />
Zusammenstellung sorgen (schließlich wird oft nur „Wissen“ abgefragt)<br />
2) Entwurf von Testitems bzw. Aufgaben<br />
� Inhaltlich sollten die Items für die einzelnen Zellen der Lehrzielmatrix<br />
repräsentativ sein.<br />
� Was die formale Gestaltung der Items betrifft, gibt es folgende<br />
Möglichkeiten:<br />
a) Gebundene Aufgabenbeantwortung<br />
- Auswahlantworten (Richtig/Falsch- und Mehrfachwahlaufgaben)<br />
- Ordnungsantwortaufgaben (Zuordnung- und Umordnungsaufgaben)<br />
b) Freie Aufgabenbeantwortung<br />
- Ergänzungsaufgaben (Lücken)<br />
- Kurzantwortaufgaben<br />
- Kurzaufsatzaufgaben<br />
3) Vorerprobung an wenigen Fällen (um die Verständlichkeit der<br />
Aufgabenformulierungen zu überprüfen, evtl. Revision der Items)<br />
4) Testdurchführung an einer kleinen Stichprobe (200-400 Schüler)<br />
5) Aufgaben- und Testanalyse anhand der so gewonnen Daten<br />
� Berechnung der Aufgabenschwierigkeit: der Schwierigkeitsindex einer<br />
Aufgabe (Pi) entspricht dabei dem prozentualen Anteil der richtigen<br />
Lösungen zu dieser Aufgabe; heißt: je höher die statistische Schwierigkeit,<br />
desto einfacher die Aufgabe!<br />
- Die Schwierigkeitsindices sollten zwischen .20 und .80 streuen (damit<br />
der Test maximal diskriminiert)<br />
- Zum Einstieg sollten leichtere Items gewählt werden<br />
(Eisbrecherfunktion); danach ansteigender Schwierigkeitsgrad (zwecks<br />
Erhaltung der Testmotivation)<br />
- Je nachdem, ob der Test eher im oberen oder unteren Leistungsbereich<br />
differenzieren soll, werden mehr schwierige oder mehr leichte<br />
Aufgaben beibehalten.<br />
� Distraktorenanalyse: Wie oft werden welche Distraktoren gewählt?<br />
- 10% = geeigneter Distraktor; 15% = guter Distraktor<br />
- Wird eine falsche Antwort zu häufig gewählt, kann das ein Hinweis auf<br />
fehlleitende Instruktion sein (oder eben auf typische Denkfehler)<br />
- Ein Distraktor, der nie gewählt wird, ist ungeeignet.<br />
� Trennschärfeberechnung: Die Trennschärfe einer Aufgabe gibt an, wie<br />
gut sie zwischen guten und schlechten Pbn differenziert; der<br />
Trennschärfekoeffizient entspricht der Korrelation zwischen dem<br />
Aufgabenwert und dem Gesamttestwert (rit liegt zw. -1,0 und +1,0).<br />
- Ein hoher Trennschärfekoeffizient besagt, dass die Pbn, die die<br />
betreffende Aufgabe richtig gelöst haben, auch im Gesamttest gut<br />
waren; hohe Trennschärfen sind v. a. bei Aufgaben mittlerer<br />
Schwierigkeit zu erwarten.<br />
- Ein Trennschärfekoeffizient von 0 besagt, dass gute und schlechte Pbn<br />
die Aufgabe in etwa gleich häufig gelöst bzw. nicht gelöst haben (=><br />
Item ist unbrauchbar)<br />
- Ein negativer Trennschärfekoeffizient besagt, dass das Item eher von<br />
schlechten Pbn gelöst wurde (Item muss entfernt oder umformuliert<br />
werden)<br />
� Reliabilitäts-(Homogenitäts-)Schätzung<br />
82