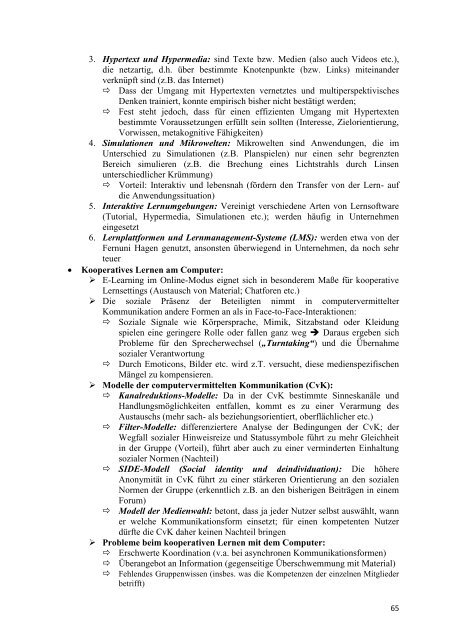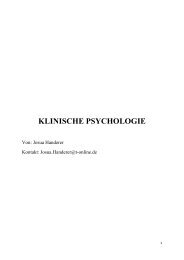A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3. Hypertext und Hypermedia: sind Texte bzw. Medien (also auch Videos etc.),<br />
die netzartig, d.h. über bestimmte Knotenpunkte (bzw. Links) miteinander<br />
verknüpft sind (z.B. das Internet)<br />
� Dass der Umgang mit Hypertexten vernetztes und multiperspektivisches<br />
Denken trainiert, konnte empirisch bisher nicht bestätigt werden;<br />
� Fest steht jedoch, dass für einen effizienten Umgang mit Hypertexten<br />
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein sollten (Interesse, Zielorientierung,<br />
Vorwissen, metakognitive Fähigkeiten)<br />
4. Simulationen und Mikrowelten: Mikrowelten sind Anwendungen, die im<br />
Unterschied zu Simulationen (z.B. Planspielen) nur einen sehr begrenzten<br />
Bereich simulieren (z.B. die Brechung eines Lichtstrahls durch Linsen<br />
unterschiedlicher Krümmung)<br />
� Vorteil: Interaktiv und lebensnah (fördern den Transfer von der Lern- auf<br />
die Anwendungssituation)<br />
5. Interaktive Lernumgebungen: Vereinigt verschiedene Arten von Lernsoftware<br />
(Tutorial, Hypermedia, Simulationen etc.); werden häufig in Unternehmen<br />
eingesetzt<br />
6. Lernplattformen und Lernmanagement-Systeme (LMS): werden etwa von der<br />
Fernuni Hagen genutzt, ansonsten überwiegend in Unternehmen, da noch sehr<br />
teuer<br />
� Kooperatives Lernen am Computer:<br />
� E-Learning im Online-Modus eignet sich in besonderem Maße für kooperative<br />
Lernsettings (Austausch von Material; Chatforen etc.)<br />
� Die soziale Präsenz der Beteiligten nimmt in computervermittelter<br />
Kommunikation andere Formen an als in Face-to-Face-Interaktionen:<br />
� Soziale Signale wie Körpersprache, Mimik, Sitzabstand oder Kleidung<br />
spielen eine geringere Rolle oder fallen ganz weg � Daraus ergeben sich<br />
Probleme für den Sprecherwechsel („Turntaking“) und die Übernahme<br />
sozialer Verantwortung<br />
� Durch Emoticons, Bilder etc. wird z.T. versucht, diese medienspezifischen<br />
Mängel zu kompensieren.<br />
� Modelle der computervermittelten Kommunikation (CvK):<br />
� Kanalreduktions-Modelle: Da in der CvK bestimmte Sinneskanäle und<br />
Handlungsmöglichkeiten entfallen, kommt es zu einer Verarmung des<br />
Austauschs (mehr sach- als beziehungsorientiert, oberflächlicher etc.)<br />
� Filter-Modelle: differenziertere Analyse der Bedingungen der CvK; der<br />
Wegfall sozialer Hinweisreize und Statussymbole führt zu mehr Gleichheit<br />
in der Gruppe (Vorteil), führt aber auch zu einer verminderten Einhaltung<br />
sozialer Normen (Nachteil)<br />
� SIDE-Modell (Social identity und deindividuation): Die höhere<br />
Anonymität in CvK führt zu einer stärkeren Orientierung an den sozialen<br />
Normen der Gruppe (erkenntlich z.B. an den bisherigen Beiträgen in einem<br />
Forum)<br />
� Modell der Medienwahl: betont, dass ja jeder Nutzer selbst auswählt, wann<br />
er welche Kommunikationsform einsetzt; für einen kompetenten Nutzer<br />
dürfte die CvK daher keinen Nachteil bringen<br />
� Probleme beim kooperativen Lernen mit dem Computer:<br />
� Erschwerte Koordination (v.a. bei asynchronen Kommunikationsformen)<br />
� Überangebot an Information (gegenseitige Überschwemmung mit Material)<br />
� Fehlendes Gruppenwissen (insbes. was die Kompetenzen der einzelnen Mitglieder<br />
betrifft)<br />
65