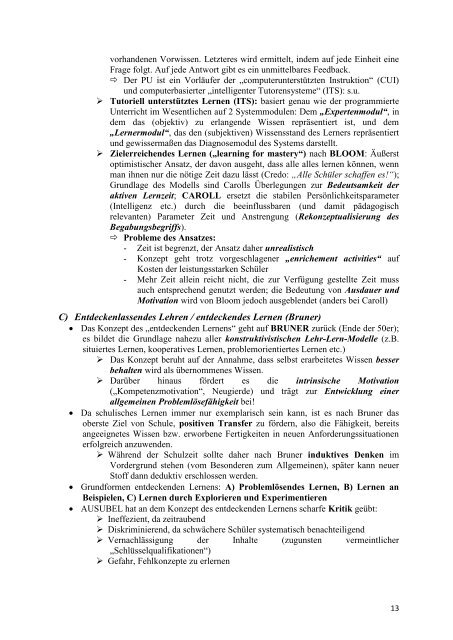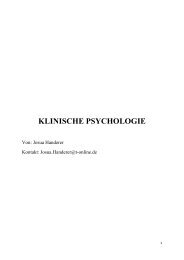A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
vorhandenen Vorwissen. Letzteres wird ermittelt, indem auf jede Einheit eine<br />
Frage folgt. Auf jede Antwort gibt es ein unmittelbares Feedback.<br />
� Der PU ist ein Vorläufer der „computerunterstützten Instruktion“ (CUI)<br />
und computerbasierter „intelligenter Tutorensysteme“ (ITS): s.u.<br />
� Tutoriell unterstütztes Lernen (ITS): basiert genau wie der programmierte<br />
Unterricht im Wesentlichen auf 2 Systemmodulen: Dem „Expertenmodul“, in<br />
dem das (objektiv) zu erlangende Wissen repräsentiert ist, und dem<br />
„Lernermodul“, das den (subjektiven) Wissensstand des Lerners repräsentiert<br />
und gewissermaßen das Diagnosemodul des Systems darstellt.<br />
� Zielerreichendes Lernen („learning for mastery“) nach BLOOM: Äußerst<br />
optimistischer Ansatz, der davon ausgeht, dass alle alles lernen können, wenn<br />
man ihnen nur die nötige Zeit dazu lässt (Credo: „Alle Schüler schaffen es!“);<br />
Grundlage des Modells sind Carolls Überlegungen zur Bedeutsamkeit der<br />
aktiven Lernzeit; CAROLL ersetzt die stabilen Persönlichkeitsparameter<br />
(Intelligenz etc.) durch die beeinflussbaren (und damit pädagogisch<br />
relevanten) Parameter Zeit und Anstrengung (Rekonzeptualisierung des<br />
Begabungsbegriffs).<br />
� Probleme des Ansatzes:<br />
- Zeit ist begrenzt, der Ansatz daher unrealistisch<br />
- Konzept geht trotz vorgeschlagener „enrichement activities“ auf<br />
Kosten der leistungsstarken Schüler<br />
- Mehr Zeit allein reicht nicht, die zur Verfügung gestellte Zeit muss<br />
auch entsprechend genutzt werden; die Bedeutung von Ausdauer und<br />
Motivation wird von Bloom jedoch ausgeblendet (anders bei Caroll)<br />
C) Entdeckenlassendes Lehren / entdeckendes Lernen (Bruner)<br />
� Das Konzept des „entdeckenden Lernens“ geht auf BRUNER zurück (Ende der 50er);<br />
es bildet die Grundlage nahezu aller konstruktivistischen Lehr-Lern-Modelle (z.B.<br />
situiertes Lernen, kooperatives Lernen, problemorientiertes Lernen etc.)<br />
� Das Konzept beruht auf der Annahme, dass selbst erarbeitetes Wissen besser<br />
behalten wird als übernommenes Wissen.<br />
� Darüber hinaus fördert es die intrinsische Motivation<br />
(„Kompetenzmotivation“, Neugierde) und trägt zur Entwicklung einer<br />
allgemeinen Problemlösefähigkeit bei!<br />
� Da schulisches Lernen immer nur exemplarisch sein kann, ist es nach Bruner das<br />
oberste Ziel von Schule, positiven Transfer zu fördern, also die Fähigkeit, bereits<br />
angeeignetes Wissen bzw. erworbene Fertigkeiten in neuen Anforderungssituationen<br />
erfolgreich anzuwenden.<br />
� Während der Schulzeit sollte daher nach Bruner induktives Denken im<br />
Vordergrund stehen (vom Besonderen zum Allgemeinen), später kann neuer<br />
Stoff dann deduktiv erschlossen werden.<br />
� Grundformen entdeckenden Lernens: A) Problemlösendes Lernen, B) Lernen an<br />
Beispielen, C) Lernen durch Explorieren und Experimentieren<br />
� AUSUBEL hat an dem Konzept des entdeckenden Lernens scharfe Kritik geübt:<br />
� Ineffezient, da zeitraubend<br />
� Diskriminierend, da schwächere Schüler systematisch benachteiligend<br />
� Vernachlässigung der Inhalte (zugunsten vermeintlicher<br />
„Schlüsselqualifikationen“)<br />
� Gefahr, Fehlkonzepte zu erlernen<br />
13