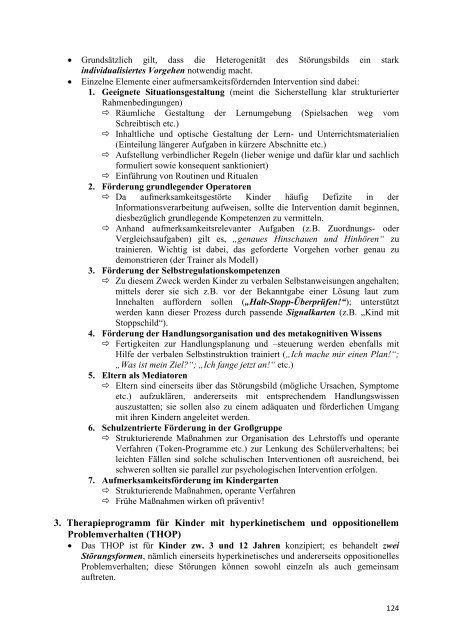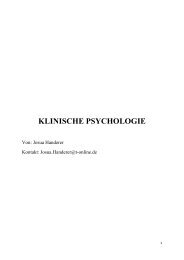A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� Grundsätzlich gilt, dass die Heterogenität des Störungsbilds ein stark<br />
individualisiertes Vorgehen notwendig macht.<br />
� Einzelne Elemente einer aufmersamkeitsfördernden Intervention sind dabei:<br />
1. Geeignete Situationsgestaltung (meint die Sicherstellung klar strukturierter<br />
Rahmenbedingungen)<br />
� Räumliche Gestaltung der Lernumgebung (Spielsachen weg vom<br />
Schreibtisch etc.)<br />
� Inhaltliche und optische Gestaltung der Lern- und Unterrichtsmaterialien<br />
(Einteilung längerer Aufgaben in kürzere Abschnitte etc.)<br />
� Aufstellung verbindlicher Regeln (lieber wenige und dafür klar und sachlich<br />
formuliert sowie konsequent sanktioniert)<br />
� Einführung von Routinen und Ritualen<br />
2. Förderung grundlegender Operatoren<br />
� Da aufmerksamkeitsgestörte Kinder häufig Defizite in der<br />
Informationsverarbeitung aufweisen, sollte die Intervention damit beginnen,<br />
diesbezüglich grundlegende Kompetenzen zu vermitteln.<br />
� Anhand aufmerksamkeitsrelevanter Aufgaben (z.B. Zuordnungs- oder<br />
Vergleichsaufgaben) gilt es, „genaues Hinschauen und Hinhören“ zu<br />
trainieren. Wichtig ist dabei, das geforderte Vorgehen vorher genau zu<br />
demonstrieren (der Trainer als Modell)<br />
3. Förderung der Selbstregulationskompetenzen<br />
� Zu diesem Zweck werden Kinder zu verbalen Selbstanweisungen angehalten;<br />
mittels derer sie sich z.B. vor der Bekanntgabe einer Lösung laut zum<br />
Innehalten auffordern sollen („Halt-Stopp-Überprüfen!“); unterstützt<br />
werden kann dieser Prozess durch passende Signalkarten (z.B. „Kind mit<br />
Stoppschild“).<br />
4. Förderung der Handlungsorganisation und des metakognitiven Wissens<br />
� Fertigkeiten zur Handlungsplanung und –steuerung werden ebenfalls mit<br />
Hilfe der verbalen Selbstinstruktion trainiert („Ich mache mir einen Plan!“;<br />
„Was ist mein Ziel?“; „Ich fange jetzt an!“ etc.)<br />
5. Eltern als Mediatoren<br />
� Eltern sind einerseits über das Störungsbild (mögliche Ursachen, Symptome<br />
etc.) aufzuklären, andererseits mit entsprechendem Handlungswissen<br />
auszustatten; sie sollen also zu einem adäquaten und förderlichen Umgang<br />
mit ihren Kindern angeleitet werden.<br />
6. Schulzentrierte Förderung in der Großgruppe<br />
� Strukturierende Maßnahmen zur Organisation des Lehrstoffs und operante<br />
Verfahren (Token-Programme etc.) zur Lenkung des Schülerverhaltens; bei<br />
leichten Fällen sind solche schulischen Interventionen oft ausreichend, bei<br />
schweren sollten sie parallel zur psychologischen Intervention erfolgen.<br />
7. Aufmerksamkeitsförderung im Kindergarten<br />
� Strukturierende Maßnahmen, operante Verfahren<br />
� Frühe Maßnahmen wirken oft präventiv!<br />
3. Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem<br />
Problemverhalten (THOP)<br />
� Das THOP ist für Kinder zw. 3 und 12 Jahren konzipiert; es behandelt zwei<br />
Störungsformen, nämlich einerseits hyperkinetisches und andererseits oppositionelles<br />
Problemverhalten; diese Störungen können sowohl einzeln als auch gemeinsam<br />
auftreten.<br />
124