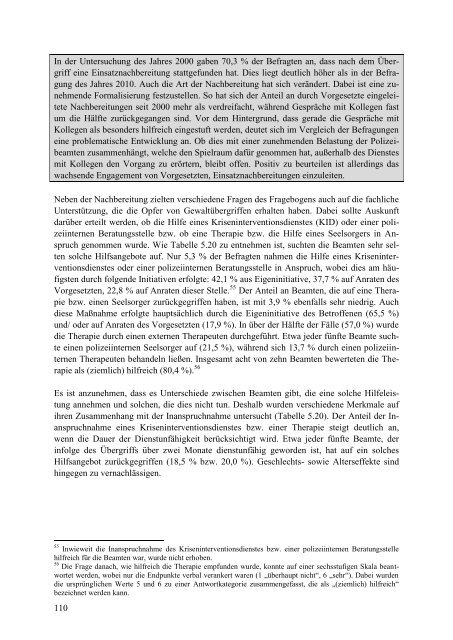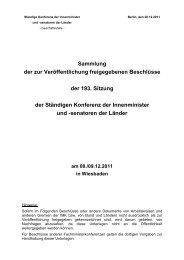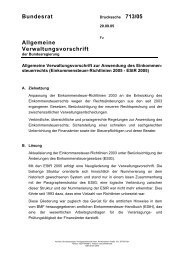Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In der Untersuchung des Jahres 2000 gaben 70,3 % der Befragten an, dass nach dem Übergriff<br />
eine Einsatznachbereitung stattgefunden hat. Dies liegt deutlich höher <strong>als</strong> in der Befragung<br />
des Jahres 2010. Auch die Art der Nachbereitung hat sich verändert. Dabei ist eine zunehmende<br />
Formalisierung festzustellen. So hat sich der Anteil an durch Vorgesetzte eingeleitete<br />
Nachbereitungen seit 2000 mehr <strong>als</strong> verdreifacht, während Gespräche mit Kollegen fast<br />
um die Hälfte zurückgegangen sind. Vor dem Hintergrund, dass gerade die Gespräche mit<br />
Kollegen <strong>als</strong> besonders hilfreich eingestuft werden, deutet sich im Vergleich der Befragungen<br />
eine problematische Entwicklung an. Ob dies mit <strong>einer</strong> zunehmenden Belastung der <strong>Polizeibeamte</strong>n<br />
zusammenhängt, welche den Spielraum dafür genommen hat, außerhalb des Dienstes<br />
mit Kollegen den Vorgang zu erörtern, bleibt offen. Positiv zu beurteilen ist allerdings das<br />
wachsende Engagement <strong>von</strong> Vorgesetzten, Einsatznachbereitungen einzuleiten.<br />
Neben der Nachbereitung zielten verschiedene Fragen des Fragebogens auch auf die fachliche<br />
Unterstützung, die die <strong>Opfer</strong> <strong>von</strong> <strong>Gewalt</strong>übergriffen erhalten haben. Dabei sollte Auskunft<br />
darüber erteilt werden, ob die Hilfe eines Kriseninterventionsdienstes (KID) oder <strong>einer</strong> polizeiinternen<br />
Beratungsstelle bzw. ob eine Therapie bzw. die Hilfe eines Seelsorgers in Anspruch<br />
genommen wurde. Wie Tabelle 5.20 zu entnehmen ist, suchten die Beamten sehr selten<br />
solche Hilfsangebote auf. Nur 5,3 % der Befragten nahmen die Hilfe eines Kriseninterventionsdienstes<br />
oder <strong>einer</strong> polizeiinternen Beratungsstelle in Anspruch, wobei dies am häufigsten<br />
durch folgende Initiativen erfolgte: 42,1 % aus Eigeninitiative, 37,7 % auf Anraten des<br />
Vorgesetzten, 22,8 % auf Anraten dieser Stelle. 55 Der Anteil an Beamten, die auf eine Therapie<br />
bzw. einen Seelsorger zurückgegriffen haben, ist mit 3,9 % ebenfalls sehr niedrig. Auch<br />
diese Maßnahme erfolgte hauptsächlich durch die Eigeninitiative des Betroffenen (65,5 %)<br />
und/ oder auf Anraten des Vorgesetzten (17,9 %). In über der Hälfte der Fälle (57,0 %) wurde<br />
die Therapie durch einen externen Therapeuten durchgeführt. Etwa jeder fünfte Beamte suchte<br />
einen polizeiinternen Seelsorger auf (21,5 %), während sich 13,7 % durch einen polizeiinternen<br />
Therapeuten behandeln ließen. Insgesamt acht <strong>von</strong> zehn Beamten bewerteten die Therapie<br />
<strong>als</strong> (ziemlich) hilfreich (80,4 %). 56<br />
Es ist anzunehmen, dass es Unterschiede zwischen Beamten gibt, die eine solche Hilfeleistung<br />
annehmen und solchen, die dies nicht tun. Deshalb wurden verschiedene Merkmale auf<br />
ihren Zusammenhang mit der Inanspruchnahme untersucht (Tabelle 5.20). Der Anteil der Inanspruchnahme<br />
eines Kriseninterventionsdienstes bzw. <strong>einer</strong> Therapie steigt deutlich an,<br />
wenn die Dauer der Dienstunfähigkeit berücksichtigt wird. Etwa jeder fünfte Beamte, der<br />
infolge des Übergriffs über zwei Monate dienstunfähig geworden ist, hat auf ein solches<br />
Hilfsangebot zurückgegriffen (18,5 % bzw. 20,0 %). Geschlechts- sowie Alterseffekte sind<br />
hingegen zu vernachlässigen.<br />
55 Inwieweit die Inanspruchnahme des Kriseninterventionsdienstes bzw. <strong>einer</strong> polizeiinternen Beratungsstelle<br />
hilfreich für die Beamten war, wurde nicht erhoben.<br />
56 Die Frage danach, wie hilfreich die Therapie empfunden wurde, konnte auf <strong>einer</strong> sechsstufigen Skala beantwortet<br />
werden, wobei nur die Endpunkte verbal verankert waren (1 „überhaupt nicht“, 6 „sehr“). Dabei wurden<br />
die ursprünglichen Werte 5 und 6 zu <strong>einer</strong> Antwortkategorie zusammengefasst, die <strong>als</strong> „(ziemlich) hilfreich“<br />
bezeichnet werden kann.<br />
110