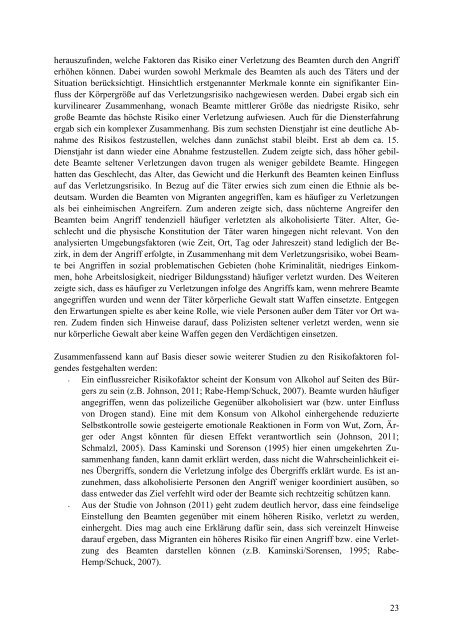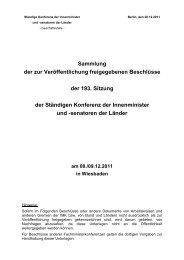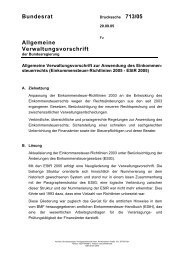Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
herauszufinden, welche Faktoren das Risiko <strong>einer</strong> Verletzung des Beamten durch den Angriff<br />
erhöhen können. Dabei wurden sowohl Merkmale des Beamten <strong>als</strong> auch des Täters und der<br />
Situation berücksichtigt. Hinsichtlich erstgenannter Merkmale konnte ein signifikanter Einfluss<br />
der Körpergröße auf das Verletzungsrisiko nachgewiesen werden. Dabei ergab sich ein<br />
kurvilinearer Zusammenhang, wonach Beamte mittlerer Größe das niedrigste Risiko, sehr<br />
große Beamte das höchste Risiko <strong>einer</strong> Verletzung aufwiesen. Auch für die Diensterfahrung<br />
ergab sich ein komplexer Zusammenhang. Bis zum sechsten Dienstjahr ist eine deutliche Abnahme<br />
des Risikos festzustellen, welches dann zunächst stabil bleibt. Erst ab dem ca. 15.<br />
Dienstjahr ist dann wieder eine Abnahme festzustellen. Zudem zeigte sich, dass höher gebildete<br />
Beamte seltener Verletzungen da<strong>von</strong> trugen <strong>als</strong> weniger gebildete Beamte. Hingegen<br />
hatten das Geschlecht, das Alter, das Gewicht und die Herkunft des Beamten keinen Einfluss<br />
auf das Verletzungsrisiko. In Bezug auf die Täter erwies sich zum einen die Ethnie <strong>als</strong> bedeutsam.<br />
Wurden die Beamten <strong>von</strong> Migranten angegriffen, kam es häufiger zu Verletzungen<br />
<strong>als</strong> bei einheimischen Angreifern. Zum anderen zeigte sich, dass nüchterne Angreifer den<br />
Beamten beim Angriff tendenziell häufiger verletzten <strong>als</strong> alkoholisierte Täter. Alter, Geschlecht<br />
und die physische Konstitution der Täter waren hingegen nicht relevant. Von den<br />
analysierten Umgebungsfaktoren (wie Zeit, Ort, Tag oder Jahreszeit) stand lediglich der Bezirk,<br />
in dem der Angriff erfolgte, in Zusammenhang mit dem Verletzungsrisiko, wobei Beamte<br />
bei Angriffen in sozial problematischen Gebieten (hohe Kriminalität, niedriges Einkommen,<br />
hohe Arbeitslosigkeit, niedriger Bildungsstand) häufiger verletzt wurden. Des Weiteren<br />
zeigte sich, dass es häufiger zu Verletzungen infolge des Angriffs kam, wenn mehrere Beamte<br />
angegriffen wurden und wenn der Täter körperliche <strong>Gewalt</strong> statt Waffen einsetzte. Entgegen<br />
den Erwartungen spielte es aber keine Rolle, wie viele Personen außer dem Täter vor Ort waren.<br />
Zudem finden sich Hinweise darauf, dass Polizisten seltener verletzt werden, wenn sie<br />
nur körperliche <strong>Gewalt</strong> aber keine Waffen gegen den Verdächtigen einsetzen.<br />
Zusammenfassend kann auf Basis dieser sowie weiterer Studien zu den Risikofaktoren folgendes<br />
festgehalten werden:<br />
- Ein einflussreicher Risikofaktor scheint der Konsum <strong>von</strong> Alkohol auf Seiten des Bürgers<br />
zu sein (z.B. Johnson, 2011; Rabe-Hemp/Schuck, 2007). Beamte wurden häufiger<br />
angegriffen, wenn das polizeiliche Gegenüber alkoholisiert war (bzw. unter Einfluss<br />
<strong>von</strong> Drogen stand). Eine mit dem Konsum <strong>von</strong> Alkohol einhergehende reduzierte<br />
Selbstkontrolle sowie gesteigerte emotionale Reaktionen in Form <strong>von</strong> Wut, Zorn, Ärger<br />
oder Angst könnten für diesen Effekt verantwortlich sein (Johnson, 2011;<br />
Schmalzl, 2005). Dass Kaminski und Sorenson (1995) hier einen umgekehrten Zusammenhang<br />
fanden, kann damit erklärt werden, dass nicht die Wahrscheinlichkeit eines<br />
Übergriffs, sondern die Verletzung infolge des Übergriffs erklärt wurde. Es ist anzunehmen,<br />
dass alkoholisierte Personen den Angriff weniger koordiniert ausüben, so<br />
dass entweder das Ziel verfehlt wird oder der Beamte sich rechtzeitig schützen kann.<br />
- Aus der Studie <strong>von</strong> Johnson (2011) geht zudem deutlich hervor, dass eine feindselige<br />
Einstellung den Beamten gegenüber mit einem höheren Risiko, verletzt zu werden,<br />
einhergeht. Dies mag auch eine Erklärung dafür sein, dass sich vereinzelt Hinweise<br />
darauf ergeben, dass Migranten ein höheres Risiko für einen Angriff bzw. eine Verletzung<br />
des Beamten darstellen können (z.B. Kaminski/Sorensen, 1995; Rabe-<br />
Hemp/Schuck, 2007).<br />
23