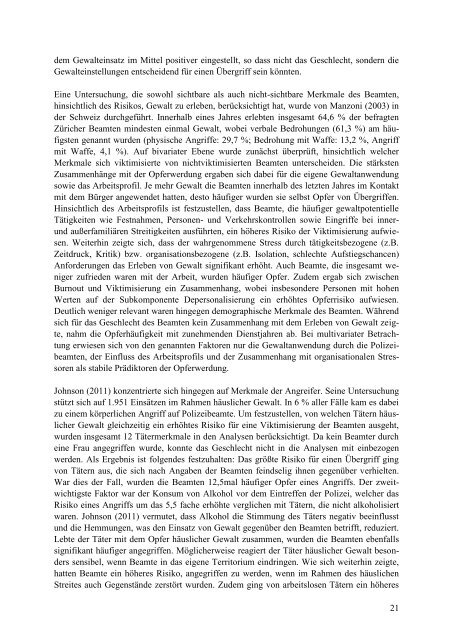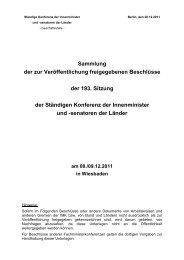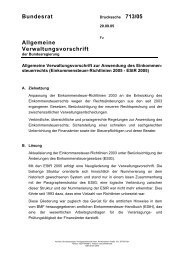Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dem <strong>Gewalt</strong>einsatz im Mittel positiver eingestellt, so dass nicht das Geschlecht, sondern die<br />
<strong>Gewalt</strong>einstellungen entscheidend für einen Übergriff sein könnten.<br />
Eine Untersuchung, die sowohl sichtbare <strong>als</strong> auch nicht-sichtbare Merkmale des Beamten,<br />
hinsichtlich des Risikos, <strong>Gewalt</strong> zu erleben, berücksichtigt hat, wurde <strong>von</strong> Manzoni (2003) in<br />
der Schweiz durchgeführt. Innerhalb eines Jahres erlebten insgesamt 64,6 % der befragten<br />
Züricher Beamten mindesten einmal <strong>Gewalt</strong>, wobei verbale Bedrohungen (61,3 %) am häufigsten<br />
genannt wurden (physische Angriffe: 29,7 %; Bedrohung mit Waffe: 13,2 %, Angriff<br />
mit Waffe, 4,1 %). Auf bivariater Ebene wurde zunächst überprüft, hinsichtlich welcher<br />
Merkmale sich viktimisierte <strong>von</strong> nichtviktimisierten Beamten unterscheiden. Die stärksten<br />
Zusammenhänge mit der <strong>Opfer</strong>werdung ergaben sich dabei für die eigene <strong>Gewalt</strong>anwendung<br />
sowie das Arbeitsprofil. Je mehr <strong>Gewalt</strong> die Beamten innerhalb des letzten Jahres im Kontakt<br />
mit dem Bürger angewendet hatten, desto häufiger wurden sie selbst <strong>Opfer</strong> <strong>von</strong> Übergriffen.<br />
Hinsichtlich des Arbeitsprofils ist festzustellen, dass Beamte, die häufiger gewaltpotentielle<br />
Tätigkeiten wie Festnahmen, Personen- und Verkehrskontrollen sowie Eingriffe bei innerund<br />
außerfamiliären Streitigkeiten ausführten, ein höheres Risiko der Viktimisierung aufwiesen.<br />
Weiterhin zeigte sich, dass der wahrgenommene Stress durch tätigkeitsbezogene (z.B.<br />
Zeitdruck, Kritik) bzw. organisationsbezogene (z.B. Isolation, schlechte Aufstiegschancen)<br />
Anforderungen das Erleben <strong>von</strong> <strong>Gewalt</strong> signifikant erhöht. Auch Beamte, die insgesamt weniger<br />
zufrieden waren mit der Arbeit, wurden häufiger <strong>Opfer</strong>. Zudem ergab sich zwischen<br />
Burnout und Viktimisierung ein Zusammenhang, wobei insbesondere Personen mit hohen<br />
Werten auf der Subkomponente Depersonalisierung ein erhöhtes <strong>Opfer</strong>risiko aufwiesen.<br />
Deutlich weniger relevant waren hingegen demographische Merkmale des Beamten. Während<br />
sich für das Geschlecht des Beamten kein Zusammenhang mit dem Erleben <strong>von</strong> <strong>Gewalt</strong> zeigte,<br />
nahm die <strong>Opfer</strong>häufigkeit mit zunehmenden Dienstjahren ab. Bei multivariater Betrachtung<br />
erwiesen sich <strong>von</strong> den genannten Faktoren nur die <strong>Gewalt</strong>anwendung durch die <strong>Polizeibeamte</strong>n,<br />
der Einfluss des Arbeitsprofils und der Zusammenhang mit organisationalen Stressoren<br />
<strong>als</strong> stabile Prädiktoren der <strong>Opfer</strong>werdung.<br />
Johnson (2011) konzentrierte sich hingegen auf Merkmale der Angreifer. Seine Untersuchung<br />
stützt sich auf 1.951 Einsätzen im Rahmen häuslicher <strong>Gewalt</strong>. In 6 % aller Fälle kam es dabei<br />
zu einem körperlichen Angriff auf <strong>Polizeibeamte</strong>. Um festzustellen, <strong>von</strong> welchen Tätern häuslicher<br />
<strong>Gewalt</strong> gleichzeitig ein erhöhtes Risiko für eine Viktimisierung der Beamten ausgeht,<br />
wurden insgesamt 12 Tätermerkmale in den Analysen berücksichtigt. Da kein Beamter durch<br />
eine Frau angegriffen wurde, konnte das Geschlecht nicht in die Analysen mit einbezogen<br />
werden. Als Ergebnis ist folgendes festzuhalten: Das größte Risiko für einen Übergriff ging<br />
<strong>von</strong> Tätern aus, die sich nach Angaben der Beamten feindselig ihnen gegenüber verhielten.<br />
War dies der Fall, wurden die Beamten 12,5mal häufiger <strong>Opfer</strong> eines Angriffs. Der zweitwichtigste<br />
Faktor war der Konsum <strong>von</strong> Alkohol vor dem Eintreffen der Polizei, welcher das<br />
Risiko eines Angriffs um das 5,5 fache erhöhte verglichen mit Tätern, die nicht alkoholisiert<br />
waren. Johnson (2011) vermutet, dass Alkohol die Stimmung des Täters negativ beeinflusst<br />
und die Hemmungen, was den Einsatz <strong>von</strong> <strong>Gewalt</strong> gegenüber den Beamten betrifft, reduziert.<br />
Lebte der Täter mit dem <strong>Opfer</strong> häuslicher <strong>Gewalt</strong> zusammen, wurden die Beamten ebenfalls<br />
signifikant häufiger angegriffen. Möglicherweise reagiert der Täter häuslicher <strong>Gewalt</strong> besonders<br />
sensibel, wenn Beamte in das eigene Territorium eindringen. Wie sich weiterhin zeigte,<br />
hatten Beamte ein höheres Risiko, angegriffen zu werden, wenn im Rahmen des häuslichen<br />
Streites auch Gegenstände zerstört wurden. Zudem ging <strong>von</strong> arbeitslosen Tätern ein höheres<br />
21