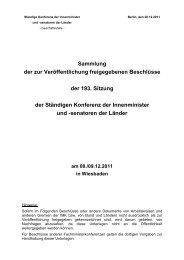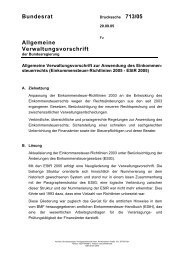Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2010, S. 135ff), aber sicherlich auch, dass auf Seiten der <strong>Polizeibeamte</strong>n nicht immer ein<br />
interkulturell kompetentes Einsatzverhalten vorliegt, so dass Einsätze in Migrantenfamilien<br />
schneller eskalieren können. Die Befunde zu den Tätern zeigen zudem, dass das Geschlecht<br />
weniger relevant ist. Von männlichen Tätern geht kein erhöhtes Viktimisierungsrisiko aus,<br />
zumindest nicht bei Einsätzen bei häuslicher <strong>Gewalt</strong>.<br />
Welche Folgen haben <strong>Gewalt</strong>übergriffe auf <strong>Polizeibeamte</strong> für die <strong>Opfer</strong> und die Täter?<br />
1. Körperliche Verletzungen und psychische Beschwerden im Zuge des <strong>Gewalt</strong>übergiffs werden<br />
<strong>von</strong> vielen Beamten berichtet. Mehr <strong>als</strong> ein Drittel der Befragten gab an, dass mindestens<br />
zwei Körperbereiche verletzt wurden. Am häufigsten kam es zu Verletzungen der Hände und<br />
Arme bzw. des Gesichts und des Kopfbereiches. Infolge des Übergriffs musste jeder zehnte<br />
Beamte stationär behandelt werden. Über ein Viertel der Beamten gab an, dass sie nach dem<br />
Übergriff Probleme mit dem Schlafen hatten; bei jedem siebten Beamten zeigten sich diese<br />
auch noch vier Wochen nach dem Übergriff. Ein Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung<br />
besteht bei jedem zwanzigsten Beamten, der einen Übergriff erlebt hat. Die psychischen<br />
Belastungen hängen dabei vor allem mit der Dauer der Dienstunfähigkeit zusammen.<br />
Fast jedes fünfte <strong>Gewalt</strong>opfer, das über zwei Monate dienstunfähig war, weist einen<br />
Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung auf.<br />
2. <strong>Gewalt</strong>übergriffe beeinflussen auch die Wahrnehmungen und Einstellungen <strong>von</strong> Beamten.<br />
Beamte, die einen Übergriff mit nachfolgender Dienstunfähigkeit erlebt haben, weisen eine<br />
höhere Furcht vor <strong>einer</strong> zukünftigen Viktimisierung auf <strong>als</strong> Beamte ohne <strong>Gewalt</strong>erfahrungen.<br />
Die Unterschiede sind dabei recht groß: Nichtopfer erachten es zu 4,1 % <strong>als</strong> eher oder sehr<br />
wahrscheinlich, in den nächsten zwölf Monaten einen Übergriff mit nachfolgender Dienstunfähigkeit<br />
zu erleben, Beamte, die einen <strong>Gewalt</strong>übergriff erlebt haben, der zu mindestens siebentägiger<br />
Dienstunfähigkeit führte, zu 30,7 %. Daneben sind die <strong>Gewalt</strong>opfer strafhärter<br />
eingestellt, was möglicherweise zur Folge hat, dass sie in direkten Interaktionen mit Ruhestörern,<br />
Straftäter usw. rigider auftreten und damit auch zur Eskalation <strong>einer</strong> Situation beitragen<br />
können. Nicht zu vernachlässigen ist, dass das professionelle Selbstbild der Beamten leidet:<br />
<strong>Gewalt</strong>opfer stimmen deutlich häufiger der Aussage zu, dass Polizisten Prügelknaben <strong>einer</strong><br />
verfehlten Politik (73,3 zu 89,5 %) und Müllmänner <strong>einer</strong> kranken Gesellschaft (57,1 zu 78,3<br />
%) seien. Eine Distanzierung vom Arbeitsalltag, an dessen Ende berufsbezogene Burnout-<br />
Erscheinungen stehen, könnte eine mögliche Folge sein. Diese Veränderungen <strong>von</strong> Wahrnehmungen<br />
und Einstellungen sind daher sehr ernst zu nehmen.<br />
3. Bislang ist die Nachbereitung eines Einsatzes, der zur Verletzung eines Beamten mit nachfolgender<br />
Dienstunfähigkeit geführt hat, noch nicht die Regel. 55,6 % der Beamten, die einen<br />
Übergriff mit Dienstunfähigkeit erlebt haben, berichteten <strong>von</strong> <strong>einer</strong> Einsatznachbereitung.<br />
Diese war häufiger informell im Dienst <strong>als</strong> informell außerhalb des Dienstes. Dass Vorgesetzte<br />
eine solche Nachbereitung einleiten, kommt in jedem dritten Fall, in dem es eine Einsatznachbereitung<br />
gab, vor. Als besonders hilfreich werden die Nachbereitungen mit Kollegen<br />
außerhalb des Dienstes wahrgenommen, die ebenfalls nur in einem Drittel der Fälle stattgefunden<br />
haben. Drei <strong>von</strong> fünf Beamten, die <strong>von</strong> k<strong>einer</strong> Nachbereitung berichteten, hätten sich<br />
eine solche gewünscht, bestenfalls informell im Dienst oder auf Initiative des Vorgesetzten<br />
hin. Die Hilfe des Kriseninterventionsdienstes nehmen nur 5,3 % der Beamten mit Übergriffserfahrungen<br />
in Anspruch, nur 3,9 % suchen einen Therapeuten oder Seelsorger auf.<br />
154