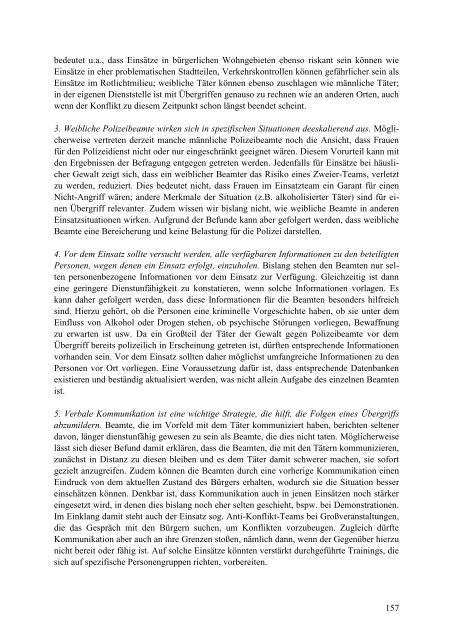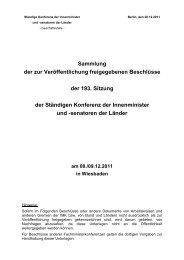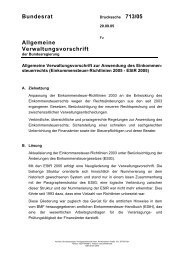Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
edeutet u.a., dass Einsätze in bürgerlichen Wohngebieten ebenso riskant sein können wie<br />
Einsätze in eher problematischen Stadtteilen, Verkehrskontrollen können gefährlicher sein <strong>als</strong><br />
Einsätze im Rotlichtmilieu; weibliche Täter können ebenso zuschlagen wie männliche Täter;<br />
in der eigenen Dienststelle ist mit Übergriffen genauso zu rechnen wie an anderen Orten, auch<br />
wenn der Konflikt zu diesem Zeitpunkt schon längst beendet scheint.<br />
3. Weibliche <strong>Polizeibeamte</strong> wirken sich in spezifischen Situationen deeskalierend aus. Möglicherweise<br />
vertreten derzeit manche männliche <strong>Polizeibeamte</strong> noch die Ansicht, dass Frauen<br />
für den Polizeidienst nicht oder nur eingeschränkt geeignet wären. Diesem Vorurteil kann mit<br />
den <strong>Ergebnisse</strong>n der Befragung entgegen getreten werden. Jedenfalls für Einsätze bei häuslicher<br />
<strong>Gewalt</strong> zeigt sich, dass ein weiblicher Beamter das Risiko eines Zweier-Teams, verletzt<br />
zu werden, reduziert. Dies bedeutet nicht, dass Frauen im Einsatzteam ein Garant für einen<br />
Nicht-Angriff wären; andere Merkmale der Situation (z.B. alkoholisierter Täter) sind für einen<br />
Übergriff relevanter. Zudem wissen wir bislang nicht, wie weibliche Beamte in anderen<br />
Einsatzsituationen wirken. Aufgrund der Befunde kann aber gefolgert werden, dass weibliche<br />
Beamte eine Bereicherung und keine Belastung für die Polizei darstellen.<br />
4. Vor dem Einsatz sollte versucht werden, alle verfügbaren Informationen zu den beteiligten<br />
Personen, wegen denen ein Einsatz erfolgt, einzuholen. Bislang stehen den Beamten nur selten<br />
personenbezogene Informationen vor dem Einsatz zur Verfügung. Gleichzeitig ist dann<br />
eine geringere Dienstunfähigkeit zu konstatieren, wenn solche Informationen vorlagen. Es<br />
kann daher gefolgert werden, dass diese Informationen für die Beamten besonders hilfreich<br />
sind. Hierzu gehört, ob die Personen eine kriminelle Vorgeschichte haben, ob sie unter dem<br />
Einfluss <strong>von</strong> Alkohol oder Drogen stehen, ob psychische Störungen vorliegen, Bewaffnung<br />
zu erwarten ist usw. Da ein Großteil der Täter der <strong>Gewalt</strong> gegen <strong>Polizeibeamte</strong> vor dem<br />
Übergriff bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, dürften entsprechende Informationen<br />
vorhanden sein. Vor dem Einsatz sollten daher möglichst umfangreiche Informationen zu den<br />
Personen vor Ort vorliegen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass entsprechende Datenbanken<br />
existieren und beständig aktualisiert werden, was nicht allein Aufgabe des einzelnen Beamten<br />
ist.<br />
5. Verbale Kommunikation ist eine wichtige Strategie, die hilft, die Folgen eines Übergriffs<br />
abzumildern. Beamte, die im Vorfeld mit dem Täter kommuniziert haben, berichten seltener<br />
da<strong>von</strong>, länger dienstunfähig gewesen zu sein <strong>als</strong> Beamte, die dies nicht taten. Möglicherweise<br />
lässt sich dieser Befund damit erklären, dass die Beamten, die mit den Tätern kommunizieren,<br />
zunächst in Distanz zu diesen bleiben und es dem Täter damit schwerer machen, sie sofort<br />
gezielt anzugreifen. Zudem können die Beamten durch eine vorherige Kommunikation einen<br />
Eindruck <strong>von</strong> dem aktuellen Zustand des Bürgers erhalten, wodurch sie die Situation besser<br />
einschätzen können. Denkbar ist, dass Kommunikation auch in jenen Einsätzen noch stärker<br />
eingesetzt wird, in denen dies bislang noch eher selten geschieht, bspw. bei Demonstrationen.<br />
Im Einklang damit steht auch der Einsatz sog. Anti-Konflikt-Teams bei Großveranstaltungen,<br />
die das Gespräch mit den Bürgern suchen, um Konflikten vorzubeugen. Zugleich dürfte<br />
Kommunikation aber auch an ihre Grenzen stoßen, nämlich dann, wenn der Gegenüber hierzu<br />
nicht bereit oder fähig ist. Auf solche Einsätze könnten verstärkt durchgeführte Trainings, die<br />
sich auf spezifische Personengruppen richten, vorbereiten.<br />
157