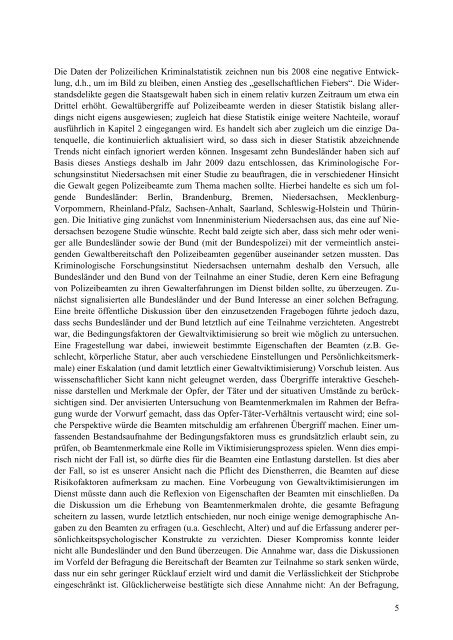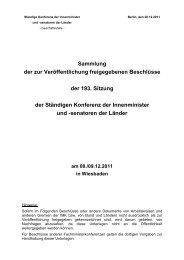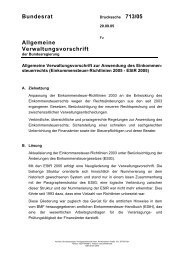Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer ... - Bundesrat
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Daten der Polizeilichen Krimin<strong>als</strong>tatistik zeichnen nun bis 2008 eine negative Entwicklung,<br />
d.h., um im Bild zu bleiben, einen Anstieg des „gesellschaftlichen Fiebers“. Die Widerstandsdelikte<br />
gegen die Staatsgewalt haben sich in einem relativ kurzen Zeitraum um etwa ein<br />
Drittel erhöht. <strong>Gewalt</strong>übergriffe auf <strong>Polizeibeamte</strong> werden in dieser Statistik bislang allerdings<br />
nicht eigens ausgewiesen; zugleich hat diese Statistik einige weitere Nachteile, worauf<br />
ausführlich in Kapitel 2 eingegangen wird. Es handelt sich aber zugleich um die einzige Datenquelle,<br />
die kontinuierlich aktualisiert wird, so dass sich in dieser Statistik abzeichnende<br />
Trends nicht einfach ignoriert werden können. Insgesamt zehn Bundesländer haben sich auf<br />
Basis dieses Anstiegs deshalb im Jahr 2009 dazu entschlossen, das Kriminologische Forschungsinstitut<br />
Niedersachsen mit <strong>einer</strong> Studie zu beauftragen, die in verschiedener Hinsicht<br />
die <strong>Gewalt</strong> gegen <strong>Polizeibeamte</strong> zum Thema machen sollte. Hierbei handelte es sich um folgende<br />
Bundesländer: Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-<br />
Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen.<br />
Die Initiative ging zunächst vom Innenministerium Niedersachsen aus, das eine auf Niedersachsen<br />
bezogene Studie wünschte. Recht bald zeigte sich aber, dass sich mehr oder weniger<br />
alle Bundesländer sowie der Bund (mit der Bundespolizei) mit der vermeintlich ansteigenden<br />
<strong>Gewalt</strong>bereitschaft den <strong>Polizeibeamte</strong>n gegenüber auseinander setzen mussten. Das<br />
Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen unternahm deshalb den Versuch, alle<br />
Bundesländer und den Bund <strong>von</strong> der Teilnahme an <strong>einer</strong> Studie, deren Kern eine Befragung<br />
<strong>von</strong> <strong>Polizeibeamte</strong>n zu ihren <strong>Gewalt</strong>erfahrungen im Dienst bilden sollte, zu überzeugen. Zunächst<br />
signalisierten alle Bundesländer und der Bund Interesse an <strong>einer</strong> solchen Befragung.<br />
Eine breite öffentliche Diskussion über den einzusetzenden Fragebogen führte jedoch dazu,<br />
dass sechs Bundesländer und der Bund letztlich auf eine Teilnahme verzichteten. Angestrebt<br />
war, die Bedingungsfaktoren der <strong>Gewalt</strong>viktimisierung so breit wie möglich zu untersuchen.<br />
Eine Fragestellung war dabei, inwieweit bestimmte Eigenschaften der Beamten (z.B. Geschlecht,<br />
körperliche Statur, aber auch verschiedene Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmale)<br />
<strong>einer</strong> Eskalation (und damit letztlich <strong>einer</strong> <strong>Gewalt</strong>viktimisierung) Vorschub leisten. Aus<br />
wissenschaftlicher Sicht kann nicht geleugnet werden, dass Übergriffe interaktive Geschehnisse<br />
darstellen und Merkmale der <strong>Opfer</strong>, der Täter und der situativen Umstände zu berücksichtigen<br />
sind. Der anvisierten Untersuchung <strong>von</strong> Beamtenmerkmalen im Rahmen der Befragung<br />
wurde der Vorwurf gemacht, dass das <strong>Opfer</strong>-Täter-Verhältnis vertauscht wird; eine solche<br />
Perspektive würde die Beamten mitschuldig am erfahrenen Übergriff machen. Einer umfassenden<br />
Bestandsaufnahme der Bedingungsfaktoren muss es grundsätzlich erlaubt sein, zu<br />
prüfen, ob Beamtenmerkmale eine Rolle im Viktimisierungsprozess spielen. Wenn dies empirisch<br />
nicht der Fall ist, so dürfte dies für die Beamten eine Entlastung darstellen. Ist dies aber<br />
der Fall, so ist es unserer Ansicht nach die Pflicht des Dienstherren, die Beamten auf diese<br />
Risikofaktoren aufmerksam zu machen. Eine Vorbeugung <strong>von</strong> <strong>Gewalt</strong>viktimisierungen im<br />
Dienst müsste dann auch die Reflexion <strong>von</strong> Eigenschaften der Beamten mit einschließen. Da<br />
die Diskussion um die Erhebung <strong>von</strong> Beamtenmerkmalen drohte, die gesamte Befragung<br />
scheitern zu lassen, wurde letztlich entschieden, nur noch einige wenige demographische Angaben<br />
zu den Beamten zu erfragen (u.a. Geschlecht, Alter) und auf die Erfassung anderer persönlichkeitspsychologischer<br />
Konstrukte zu verzichten. Dieser Kompromiss konnte leider<br />
nicht alle Bundesländer und den Bund überzeugen. Die Annahme war, dass die Diskussionen<br />
im Vorfeld der Befragung die Bereitschaft der Beamten zur Teilnahme so stark senken würde,<br />
dass nur ein sehr geringer Rücklauf erzielt wird und damit die Verlässlichkeit der Stichprobe<br />
eingeschränkt ist. Glücklicherweise bestätigte sich diese Annahme nicht: An der Befragung,<br />
5