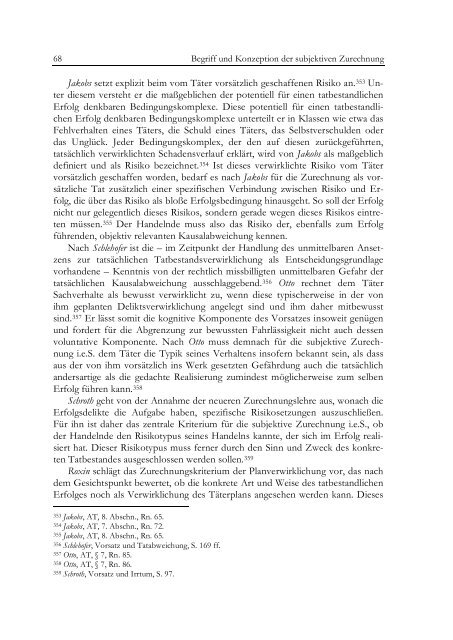Der markenstrafrechtliche subjektive Tatbestand
Der markenstrafrechtliche subjektive Tatbestand
Der markenstrafrechtliche subjektive Tatbestand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
68 Begriff und Konzeption der <strong>subjektive</strong>n Zurechnung<br />
Jakobs setzt explizit beim vom Täter vorsätzlich geschaffenen Risiko an. 353 Unter<br />
diesem versteht er die maßgeblichen der potentiell für einen tatbestandlichen<br />
Erfolg denkbaren Bedingungskomplexe. Diese potentiell für einen tatbestandlichen<br />
Erfolg denkbaren Bedingungskomplexe unterteilt er in Klassen wie etwa das<br />
Fehlverhalten eines Täters, die Schuld eines Täters, das Selbstverschulden oder<br />
das Unglück. Jeder Bedingungskomplex, der den auf diesen zurückgeführten,<br />
tatsächlich verwirklichten Schadensverlauf erklärt, wird von Jakobs als maßgeblich<br />
definiert und als Risiko bezeichnet. 354 Ist dieses verwirklichte Risiko vom Täter<br />
vorsätzlich geschaffen worden, bedarf es nach Jakobs für die Zurechnung als vorsätzliche<br />
Tat zusätzlich einer spezifischen Verbindung zwischen Risiko und Erfolg,<br />
die über das Risiko als bloße Erfolgsbedingung hinausgeht. So soll der Erfolg<br />
nicht nur gelegentlich dieses Risikos, sondern gerade wegen dieses Risikos eintreten<br />
müssen. 355 <strong>Der</strong> Handelnde muss also das Risiko der, ebenfalls zum Erfolg<br />
führenden, objektiv relevanten Kausalabweichung kennen.<br />
Nach Schlehofer ist die – im Zeitpunkt der Handlung des unmittelbaren Ansetzens<br />
zur tatsächlichen <strong>Tatbestand</strong>sverwirklichung als Entscheidungsgrundlage<br />
vorhandene – Kenntnis von der rechtlich missbilligten unmittelbaren Gefahr der<br />
tatsächlichen Kausalabweichung ausschlaggebend. 356 Otto rechnet dem Täter<br />
Sachverhalte als bewusst verwirklicht zu, wenn diese typischerweise in der von<br />
ihm geplanten Deliktsverwirklichung angelegt sind und ihm daher mitbewusst<br />
sind. 357 Er lässt somit die kognitive Komponente des Vorsatzes insoweit genügen<br />
und fordert für die Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit nicht auch dessen<br />
voluntative Komponente. Nach Otto muss demnach für die <strong>subjektive</strong> Zurechnung<br />
i.e.S. dem Täter die Typik seines Verhaltens insofern bekannt sein, als dass<br />
aus der von ihm vorsätzlich ins Werk gesetzten Gefährdung auch die tatsächlich<br />
andersartige als die gedachte Realisierung zumindest möglicherweise zum selben<br />
Erfolg führen kann. 358<br />
Schroth geht von der Annahme der neueren Zurechnungslehre aus, wonach die<br />
Erfolgsdelikte die Aufgabe haben, spezifische Risikosetzungen auszuschließen.<br />
Für ihn ist daher das zentrale Kriterium für die <strong>subjektive</strong> Zurechnung i.e.S., ob<br />
der Handelnde den Risikotypus seines Handelns kannte, der sich im Erfolg realisiert<br />
hat. Dieser Risikotypus muss ferner durch den Sinn und Zweck des konkreten<br />
<strong>Tatbestand</strong>es ausgeschlossen werden sollen. 359<br />
Roxin schlägt das Zurechnungskriterium der Planverwirklichung vor, das nach<br />
dem Gesichtspunkt bewertet, ob die konkrete Art und Weise des tatbestandlichen<br />
Erfolges noch als Verwirklichung des Täterplans angesehen werden kann. Dieses<br />
353 Jakobs, AT, 8. Abschn., Rn. 65.<br />
354 Jakobs, AT, 7. Abschn., Rn. 72.<br />
355 Jakobs, AT, 8. Abschn., Rn. 65.<br />
356 Schlehofer, Vorsatz und Tatabweichung, S. 169 ff.<br />
357 Otto, AT, § 7, Rn. 85.<br />
358 Otto, AT, § 7, Rn. 86.<br />
359 Schroth, Vorsatz und Irrtum, S. 97.