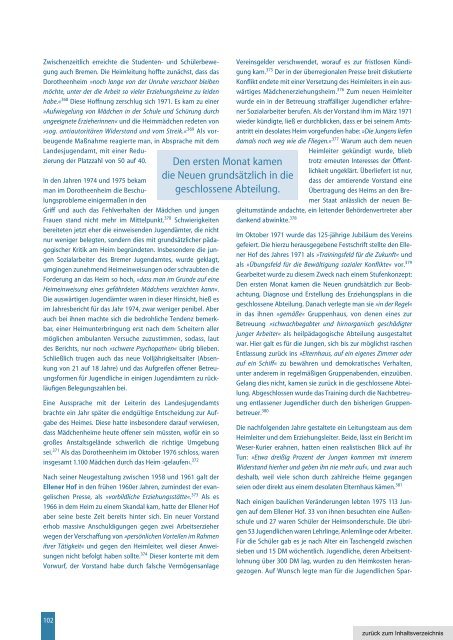1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zwischenzeitlich erreichte die Studenten- und Schülerbewegung<br />
auch Bremen. Die Heimleitung hoffte zunächst, dass das<br />
Dorotheenheim »noch lange von der Unruhe verschont bleiben<br />
möchte, unter der die Arbeit so vieler Erziehungsheime zu leiden<br />
habe.« 368 Diese Hoffnung zerschlug sich 1971. Es kam zu einer<br />
»Aufwiegelung von Mädchen in der Schule und Schürung durch<br />
ungeeignete Erzieherinnen« und die Heimmädchen redeten von<br />
»sog. antiautoritären Widerstand und vom Streik.« 369 Als vorbeugende<br />
Maßnahme reagierte man, in Absprache mit dem<br />
Landesjugendamt, mit einer Reduzierung<br />
der Platzzahl von 50 auf 40.<br />
In den Jahren 1974 und 1975 bekam<br />
man im Dorotheenheim die Beschulungsprobleme<br />
einigermaßen in den<br />
Griff und auch das Fehlverhalten der Mädchen und jungen<br />
Frauen stand nicht mehr im Mittelpunkt. 370 Schwierigkeiten<br />
bereiteten jetzt eher die einweisenden Jugendämter, die nicht<br />
nur weniger belegten, sondern dies mit grundsätzlicher pädagogischer<br />
Kritik am Heim begründeten. Insbesondere die jungen<br />
Sozialarbeiter des Bremer Jugendamtes, wurde geklagt,<br />
umgingen zunehmend Heimeinweisungen oder schraubten die<br />
Forderung an das Heim so hoch, »dass man im Grunde auf eine<br />
Heimeinweisung eines gefährdeten Mädchens verzichten kann«.<br />
Die auswärtigen Jugendämter waren in dieser Hinsicht, hieß es<br />
im Jahresbericht für das Jahr 1974, zwar weniger penibel. Aber<br />
auch bei ihnen machte sich die bedrohliche Tendenz bemerkbar,<br />
einer Heimunterbringung erst nach dem Scheitern aller<br />
möglichen ambulanten Versuche zuzustimmen, sodass, laut<br />
des Berichts, nur noch »schwere Psychopathen« übrig blieben.<br />
Schließlich trugen auch das neue Volljährigkeitsalter (Absenkung<br />
von 21 auf 18 Jahre) und das Aufgreifen offener Betreuungsformen<br />
für Jugendliche in einigen Jugendämtern zu rückläufigen<br />
Belegungszahlen bei.<br />
Eine Aussprache mit der Leiterin des Landesjugendamts<br />
brachte ein Jahr später die endgültige Entscheidung zur Aufgabe<br />
des Heimes. Diese hatte insbesondere darauf verwiesen,<br />
dass Mädchenheime heute offener sein müssten, wofür ein so<br />
großes Anstaltsgelände schwerlich die richtige Umgebung<br />
sei. 371 Als das Dorotheenheim im Oktober 1976 schloss, waren<br />
insgesamt 1.100 Mädchen durch das Heim ›gelaufen‹. 372<br />
Nach seiner Neugestaltung zwischen 1958 und 1961 galt der<br />
Ellener Hof in den frühen 1960er Jahren, zumindest der evangelischen<br />
Presse, als »vorbildliche Erziehungsstätte«. 373 Als es<br />
1966 in dem Heim zu einem Skandal kam, hatte der Ellener Hof<br />
aber seine beste Zeit bereits hinter sich. Ein neuer Vorstand<br />
erhob massive Anschuldigungen gegen zwei Arbeitserzieher<br />
wegen der Verschaffung von »persönlichen Vorteilen im Rahmen<br />
ihrer Tätigkeit« und gegen den Heimleiter, weil dieser Anweisungen<br />
nicht befolgt haben sollte. 374 Dieser konterte mit dem<br />
Vorwurf, der Vorstand habe durch falsche Vermögensanlage<br />
Den ersten Monat kamen<br />
die Neuen grundsätzlich in die<br />
geschlossene Abteilung.<br />
Vereinsgelder verschwendet, worauf es zur fristlosen Kündigung<br />
kam. 375 Der in der überregionalen Presse breit diskutierte<br />
Konflikt endete mit einer Versetzung des Heimleiters in ein auswärtiges<br />
Mädchenerziehungsheim. 376 Zum neuen Heimleiter<br />
wurde ein in der Betreuung straffälliger Jugendlicher erfahrener<br />
Sozialarbeiter berufen. Als der Vorstand ihm im März 1971<br />
wieder kündigte, ließ er durchblicken, dass er bei seinem Amtsantritt<br />
ein desolates Heim vorgefunden habe: »Die Jungens liefen<br />
damals noch weg wie die Fliegen.« 377 Warum auch dem neuen<br />
Heimleiter gekündigt wurde, blieb<br />
trotz erneuten Interesses der Öffentlichkeit<br />
ungeklärt. Überliefert ist nur,<br />
dass der amtierende Vorstand eine<br />
Übertragung des Heims an den Bremer<br />
Staat anlässlich der neuen Begleitumstände<br />
andachte, ein leitender Behördenvertreter aber<br />
dankend abwinkte. 378<br />
Im Oktober 1971 wurde das 125-jährige Jubiläum des Vereins<br />
gefeiert. Die hierzu herausgegebene Festschrift stellte den Ellener<br />
Hof des Jahres 1971 als »Trainingsfeld für die Zukunft« und<br />
als »Übungsfeld für die Bewältigung sozialer Konflikte« vor. 379<br />
Gearbeitet wurde zu diesem Zweck nach einem Stufenkonzept:<br />
Den ersten Monat kamen die Neuen grundsätzlich zur Beobachtung,<br />
Diagnose und Erstellung des Erziehungsplans in die<br />
geschlossene Abteilung. Danach verlegte man sie »in der Regel«<br />
in das ihnen »gemäße« Gruppenhaus, von denen eines zur<br />
Betreuung »schwachbegabter und hirnorganisch geschädigter<br />
junger Arbeiter« als heilpädagogische Abteilung ausgestaltet<br />
war. Hier galt es für die Jungen, sich bis zur möglichst raschen<br />
Entlassung zurück ins »Elternhaus, auf ein eigenes Zimmer oder<br />
auf ein Schiff« zu bewähren und demokratisches Verhalten,<br />
unter anderem in regelmäßigen Gruppenabenden, einzuüben.<br />
Gelang dies nicht, kamen sie zurück in die geschlossene Abteilung.<br />
Abgeschlossen wurde das Training durch die Nachbetreuung<br />
entlassener Jugendlicher durch den bisherigen Gruppenbetreuer.<br />
380<br />
Die nachfolgenden Jahre gestaltete ein Leitungsteam aus dem<br />
Heimleiter und dem Erziehungsleiter. Beide, lässt ein Bericht im<br />
Weser-Kurier erahnen, hatten einen realistischen Blick auf ihr<br />
Tun: »Etwa dreißig Prozent der Jungen kommen mit innerem<br />
Widerstand hierher und geben ihn nie mehr auf«, und zwar auch<br />
deshalb, weil viele schon durch zahlreiche Heime gegangen<br />
seien oder direkt aus einem desolaten Elternhaus kämen. 381<br />
Nach einigen baulichen Veränderungen lebten 1975 113 Jungen<br />
auf dem Ellener Hof. 33 von ihnen besuchten eine Außenschule<br />
und 27 waren Schüler der Heimsonderschule. Die übrigen<br />
53 Jugendlichen waren Lehrlinge, Anlernlinge oder Arbeiter.<br />
Für die Schüler gab es je nach Alter ein Taschengeld zwischen<br />
sieben und 15 DM wöchentlich. Jugendliche, deren Arbeitsentlohnung<br />
über 300 DM lag, wurden zu den Heimkosten herangezogen.<br />
Auf Wunsch legte man für die Jugendlichen Spar-<br />
102