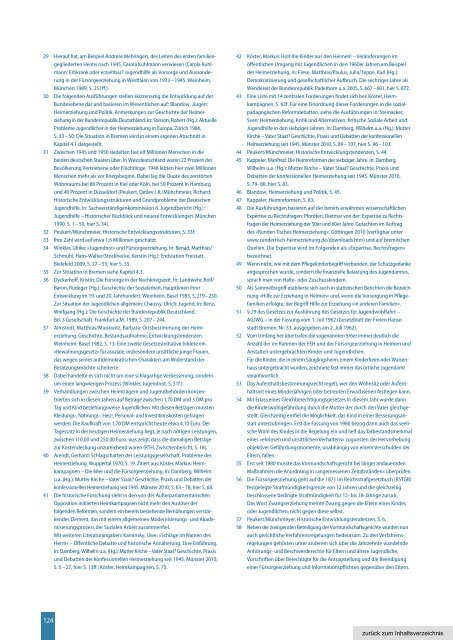1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
29 Hierauf hat, am Beispiel Andreas Mehringers, des Leiters des ersten familiengegliederten<br />
Heims nach 1945, Carola Kuhlmann verwiesen (Carola Kuhlmann:<br />
Erbkrank oder erziehbar Jugendhilfe als Vorsorge und Aussonderung<br />
in der Fürsorgeerziehung in Westfalen von 1933 – 1945. Weinheim,<br />
München 1989, S. 251ff.).<br />
30 Die folgenden Ausführungen stellen skizzenartig die Entwicklung auf der<br />
Bundesebene dar und basieren im Wesentlichen auf: Blandow, Jürgen:<br />
Heimerziehung und Politik. Anmerkungen zur Geschichte der Heimerziehung<br />
in der Bundesrepublik Deutschland. In: Soisson, Robert (Hg.): Aktuelle<br />
Probleme Jugendlicher in der Heimerziehung in Europa. Zürich 1986,<br />
S. 33 – 50. Die Situation in Bremen wird in einem eigenen Abschnitt in<br />
Kapitel 4.1 dargestellt.<br />
31 Zwischen 1945 und 1950 siedelten fast elf Millionen Menschen in die<br />
beiden deutschen Staaten über. In Westdeutschland waren 22 Prozent der<br />
Bevölkerung Vertriebene oder Flüchtlinge. 1946 lebten hier zwei Millionen<br />
Menschen mehr als vor Kriegsbeginn. Dabei lag die Quote des zerstörten<br />
Wohnraums bei 80 Prozent in Kiel oder Köln, bei 50 Prozent in Hamburg<br />
und 40 Prozent in Düsseldorf (Peukert, Detlev J.K./Münchmeier, Richard:<br />
Historische Entwicklungsstrukturen und Grundprobleme der Deutschen<br />
Jugendhilfe. In: Sachverständigenkommission 8. Jugendbericht (Hg.):<br />
Jugendhilfe – Historischer Rückblick und neuere Entwicklungen. München<br />
1990, S. 1 – 50, hier S. 34).<br />
32 Peukert/Münchmeier, Historische Entwicklungsstrukturen, S. 33f.<br />
33 Ihre Zahl wird auf etwa 1,6 Millionen geschätzt.<br />
34 Winkler, Ulrike: »Jugendnot« und Fürsorgeerziehung. In: Benad, Matthias/<br />
Schmuhl, Hans-Walter/Stockhecke, Kerstin (Hg.): Endstation Freistatt.<br />
Bielefeld 2009, S. 27 – 53, hier S. 35.<br />
35 Zur Situation in Bremen siehe Kapitel 4.1.<br />
36 Dyckerhoff, Kristin: Die Fürsorge in der Nachkriegszeit. In: Landwehr, Rolf/<br />
Baron, Rüdeger (Hg.): Geschichte der Sozialarbeit. Hauptlinien ihrer<br />
Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Weinheim, Basel 1983, S. 219 – 250.<br />
Zur Situation der Jugendlichen allgemein: Chaussy, Ulrich: Jugend. In: Benz,<br />
Wolfgang (Hg.): Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Bd. 3 Gesellschaft. Frankfurt a.M. 1989, S. 207 – 244.<br />
37 Almstedt, Matthias/Munkwitz, Barbara: Ortsbestimmung der Heimerziehung.<br />
Geschichte, Bestandsaufnahme, Entwicklungstendenzen.<br />
Weinheim, Basel 1982, S. 13. Eine zweite Gesetzesinitiative bildete ein<br />
»Bewahrungsgesetz« für asoziale, insbesondere unsittliche junge Frauen,<br />
das wegen seines antidemokratischen Charakters am Widerstand der<br />
Besatzungsmächte scheiterte.<br />
38 Dabei handelte es sich nicht um eine schlagartige Verbesserung, sondern<br />
um einen langwierigen Prozess (Winkler, Jugendnot, S. 31f.).<br />
39 Verhandlungen zwischen Heimträgern und Jugendbehörden konzentrierten<br />
sich in diesen Jahren auf Beträge zwischen 1,70 DM und 3 DM pro<br />
Tag und Kind beziehungsweise Jugendlichen. Mit diesen Beträgen mussten<br />
Kleidungs-, Nahrungs-, Heiz-, Personal- und Investitionskosten getragen<br />
werden. Die Kaufkraft von 1,70 DM entspricht heute etwa 4,10 Euro. Der<br />
Tagessatz in der heutigen Heimerziehung liegt, je nach nötigen Leistungen,<br />
zwischen 110,00 und 250,00 Euro, was zeigt, dass die damaligen Beträge<br />
zur Kostendeckung unzureichend waren (RTH, Zwischenbericht, S. 18).<br />
40 Arendt, Gerhard: Schlagschatten der Leistungsgesellschaft. Probleme der<br />
Heimerziehung. Wuppertal 1970, S. 19. Zitiert aus: Köster, Markus: Heimkampagnen<br />
– Die 68er und die Fürsorgeerziehung. In: Damberg, Wilhelm<br />
u.a. (Hg.): Mutter Kirche – Vater Staat Geschichte, Praxis und Debatten der<br />
konfessionellen Heimerziehung seit 1945. Münster 2010, S. 63 – 78, hier S. 68.<br />
41 Die historische Forschung sieht in den von der Außerparlamentarischen<br />
Opposition initiierten Heimkampagnen nicht mehr den Auslöser der<br />
folgenden Reformen, sondern ein bereits bestehende Bemühungen verstärkendes<br />
Element, das mit einem allgemeinen Modernisierungs- und Akademisierungsprozess<br />
der Sozialen Arbeit zusammenfiel.<br />
Mit weiteren Literaturangaben: Kaminsky, Uwe: »Schläge im Namen des<br />
Herrn« – Öffentliche Debatte und historische Annäherung. Eine Einführung.<br />
In: Damberg, Wilhelm u.a. (Hg.): Mutter Kirche – Vater Staat Geschichte, Praxis<br />
und Debatten der konfessionellen Heimerziehung seit 1945. Münster 2010,<br />
S. 5 – 27, hier S. 13ff.; Köster, Heimkampagnen, S. 75.<br />
42 Köster, Markus: Holt die Kinder aus den Heimen! – Veränderungen im<br />
öffentlichen Umgang mit Jugendlichen in den 1960er Jahren am Beispiel<br />
der Heimerziehung. In: Frese, Matthias/Paulus, Julia/Teppe, Karl (Hg.):<br />
Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufbruch. Die sechziger Jahre als<br />
Wendezeit der Bundesrepublik. Paderborn u.a. 2005, S. 667 – 681, hier S. 672.<br />
43 Eine Liste mit 14 zentralen Forderungen findet sich bei: Köster, Heimkampagnen,<br />
S. 63f. Für eine Einordnung dieser Forderungen in die sozialpädagogischen<br />
Reformdebatten, siehe die Ausführungen in: Steinacker,<br />
Sven: Heimerziehung, Kritik und Alternativen. Kritische Soziale Arbeit und<br />
Jugendhilfe in den siebziger Jahren. In: Damberg, Wilhelm u.a. (Hg.): Mutter<br />
Kirche – Vater Staat Geschichte, Praxis und Debatten der konfessionellen<br />
Heimerziehung seit 1945. Münster 2010, S. 89 – 107, hier S. 96 – 103.<br />
44 Peukert/Münchmeier, Historische Entwicklungstendenzen, S. 44.<br />
45 Kappeler, Manfred: Die Heimreformen der siebziger Jahre. In: Damberg,<br />
Wilhelm u.a. (Hg.): Mutter Kirche – Vater Staat Geschichte, Praxis und<br />
Debatten der konfessionellen Heimerziehung seit 1945. Münster 2010,<br />
S. 79- 88, hier S. 83.<br />
46 Blandow, Heimerziehung und Politik, S. 45.<br />
47 Kappeler, Heimreformen, S. 83.<br />
48 Die Ausführungen basieren auf der bereits erwähnten wissenschaftlichen<br />
Expertise zu Rechtsfragen: Pfordten, Dietmar von der: Expertise zu Rechtsfragen<br />
der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre. Gutachten im Auftrag<br />
des »Runden Tisches Heimerziehung«. Göttingen 2010 (verfügbar unter<br />
www.rundertisch-heimerziehung.de/downloads.htm) und auf bremischen<br />
Quellen. Die Expertise wird im Folgenden als »Expertise, Rechtsfragen«<br />
bezeichnet.<br />
49 Wenn nicht, wie mit dem Pflegekinderbegriff verbunden, der Schutzgedanke<br />
angesprochen wurde, sondern die finanzielle Belastung des Jugendamtes,<br />
sprach man von Halte- oder Zuschusskindern.<br />
50 Als Sammelbegriff etablierte sich auch in statistischen Berichten die Bezeichnung<br />
»Hilfe zur Erziehung in Heimen« und, wenn die Versorgung in Pflegefamilien<br />
erfolgte, der Begriff Hilfe zur Erziehung »in anderen Familien«.<br />
51 § 29 des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt –<br />
AGJWG – in der Fassung vom 1. Juli 1962 (Gesetzblatt der Freien Hansestadt<br />
Bremen, Nr. 33, ausgegeben am 2. Juli 1962).<br />
52 Vom Umfang her übertrafen die sogenannten 5/6er immer deutlich die<br />
Anzahl der im Rahmen der FEH und der Fürsorgeerziehung in Heimen und<br />
Anstalten untergebrachten Kinder und Jugendlichen.<br />
Für die Kinder, die in einem Säuglingsheim, einem Kinderheim oder Waisenhaus<br />
untergebracht wurden, zeichnete fast immer das örtliche Jugendamt<br />
verantwortlich.<br />
53 Das Aufenthaltsbestimmungsrecht regelt, wer den Wohnsitz oder Aufenthaltsort<br />
eines Minderjährigen oder betreuten Erwachsenen festlegen kann.<br />
54 Mit Erlass eines Gleichberechtigungsgesetzes in diesem Jahr wurde dann<br />
die Kindeswohlgefährdung durch die Mutter der durch den Vater gleichgestellt.<br />
Gleichzeitig entfiel die Möglichkeit, das Kind in einer Besserungsanstalt<br />
unterzubringen. Erst die Fassung von 1980 bezog dann auch das seelische<br />
Wohl des Kindes in die Regelung ein und ließ das Tatbestandsmerkmal<br />
eines »ehrlosen und unsittlichen Verhaltens« zugunsten der Hervorhebung<br />
objektiver Gefährdungsmomente, unabhängig von einem Verschulden der<br />
Eltern, fallen.<br />
55 Erst seit 1980 musste das Vormundschaftsgericht bei länger andauernden<br />
Maßnahmen die Anordnung in »angemessenen Zeitabständen« überprüfen.<br />
56 Die Fürsorgeerziehung geht auf die 1871 im Reichsstrafgesetzbuch (RSTGB)<br />
festgelegte Strafmündigkeitsgrenze von 12 Jahren und die gleichzeitig<br />
beschlossene bedingte Strafmündigkeit für 12- bis 18-Jährige zurück.<br />
Das Wort Zwangserziehung meinte Zwang gegen die Eltern eines Kindes<br />
oder Jugendlichen, nicht gegen diese selbst.<br />
57 Peukert/Münchmeyer, Historische Entwicklungstendenzen, S. 6.<br />
58 Neben der zwingenden Beteiligung der Vormundschaftsgerichte wurden nun<br />
auch gerichtliche Verfahrensregelungen bedeutsam. Zu den Verfahrensregelungen<br />
gehörten unter anderem sich über die Jahrzehnte wandelnde<br />
Anhörungs- und Beschwerderechte für Eltern und ältere Jugendliche,<br />
Vorschriften über Berechtigte für die Antragstellung und die Beendigung<br />
einer Fürsorgeerziehung und Informationspflichten gegenüber den Eltern.<br />
124