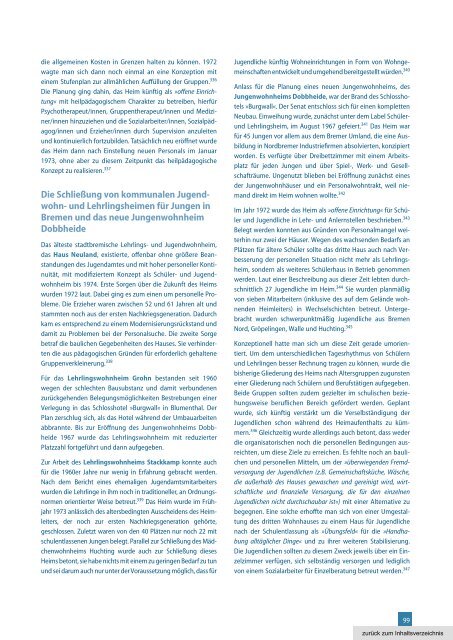1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die allgemeinen Kosten in Grenzen halten zu können. 1972<br />
wagte man sich dann noch einmal an eine Konzeption mit<br />
einem Stufenplan zur allmählichen Auffüllung der Gruppen. 336<br />
Die Planung ging dahin, das Heim künftig als »offene Einrichtung«<br />
mit heilpädagogischem Charakter zu betreiben, hierfür<br />
Psychotherapeut/innen, Gruppentherapeut/innen und Mediziner/innen<br />
hinzuziehen und die Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagog/innen<br />
und Erzieher/innen durch Supervision anzuleiten<br />
und kontinuierlich fortzubilden. Tatsächlich neu eröffnet wurde<br />
das Heim dann nach Einstellung neuen Personals im Januar<br />
1973, ohne aber zu diesem Zeitpunkt das heilpädagogische<br />
Konzept zu realisieren. 337<br />
Die Schließung von kommunalen Jugendwohn-<br />
und Lehrlingsheimen für Jungen in<br />
Bremen und das neue Jungenwohnheim<br />
Dobbheide<br />
Das älteste stadtbremische Lehrlings- und Jugendwohnheim,<br />
das Haus Neuland, existierte, offenbar ohne größere Beanstandungen<br />
des Jugendamtes und mit hoher personeller Kontinuität,<br />
mit modifiziertem Konzept als Schüler- und Jugendwohnheim<br />
bis 1974. Erste Sorgen über die Zukunft des Heims<br />
wurden 1972 laut. Dabei ging es zum einen um personelle Probleme.<br />
Die Erzieher waren zwischen 52 und 61 Jahren alt und<br />
stammten noch aus der ersten Nachkriegsgeneration. Dadurch<br />
kam es entsprechend zu einem Modernisierungsrückstand und<br />
damit zu Problemen bei der Personalsuche. Die zweite Sorge<br />
betraf die baulichen Gegebenheiten des Hauses. Sie verhinderten<br />
die aus pädagogischen Gründen für erforderlich gehaltene<br />
Gruppenverkleinerung. 338<br />
Für das Lehrlingswohnheim Grohn bestanden seit 1960<br />
wegen der schlechten Bausubstanz und damit verbundenen<br />
zurückgehenden Belegungsmöglichkeiten Bestrebungen einer<br />
Verlegung in das Schlosshotel »Burgwall« in Blumenthal. Der<br />
Plan zerschlug sich, als das Hotel während der Umbauarbeiten<br />
abbrannte. Bis zur Eröffnung des Jungenwohnheims Dobbheide<br />
1967 wurde das Lehrlingswohnheim mit reduzierter<br />
Platzzahl fortgeführt und dann aufgegeben.<br />
Zur Arbeit des Lehrlingswohnheims Stackkamp konnte auch<br />
für die 1960er Jahre nur wenig in Erfahrung gebracht werden.<br />
Nach dem Bericht eines ehemaligen Jugendamtsmitarbeiters<br />
wurden die Lehrlinge in ihm noch in traditioneller, an Ordnungsnormen<br />
orientierter Weise betreut. 339 Das Heim wurde im Frühjahr<br />
1973 anlässlich des altersbedingten Ausscheidens des Heimleiters,<br />
der noch zur ersten Nachkriegsgeneration gehörte,<br />
geschlossen. Zuletzt waren von den 40 Plätzen nur noch 22 mit<br />
schulentlassenen Jungen belegt. Parallel zur Schließung des Mädchenwohnheims<br />
Huchting wurde auch zur Schließung dieses<br />
Heims betont, sie habe nichts mit einem zu geringen Bedarf zu tun<br />
und sei darum auch nur unter der Voraussetzung möglich, dass für<br />
Jugendliche künftig Wohneinrichtungen in Form von Wohngemeinschaften<br />
entwickelt und umgehend bereit gestellt würden. 340<br />
Anlass für die Planung eines neuen Jungenwohnheims, des<br />
Jungenwohnheims Dobbheide, war der Brand des Schlosshotels<br />
»Burgwall«. Der Senat entschloss sich für einen kompletten<br />
Neubau. Einweihung wurde, zunächst unter dem Label Schülerund<br />
Lehrlingsheim, im August 1967 gefeiert. 341 Das Heim war<br />
für 45 Jungen vor allem aus dem Bremer Umland, die eine Ausbildung<br />
in Nordbremer Industriefirmen absolvierten, konzipiert<br />
worden. Es verfügte über Dreibettzimmer mit einem Arbeitsplatz<br />
für jeden Jungen und über Spiel-, Werk- und Gesellschafträume.<br />
Ungenutzt blieben bei Eröffnung zunächst eines<br />
der Jungenwohnhäuser und ein Personalwohntrakt, weil niemand<br />
direkt im Heim wohnen wollte. 342<br />
Im Jahr 1972 wurde das Heim als »offene Einrichtung« für Schüler<br />
und Jugendliche in Lehr- und Anlernstellen beschrieben. 343<br />
Belegt werden konnten aus Gründen von Personalmangel weiterhin<br />
nur zwei der Häuser. Wegen des wachsenden Bedarfs an<br />
Plätzen für ältere Schüler sollte das dritte Haus auch nach Verbesserung<br />
der personellen Situation nicht mehr als Lehrlingsheim,<br />
sondern als weiteres Schülerhaus in Betrieb genommen<br />
werden. Laut einer Beschreibung aus dieser Zeit lebten durchschnittlich<br />
27 Jugendliche im Heim. 344 Sie wurden planmäßig<br />
von sieben Mitarbeitern (inklusive des auf dem Gelände wohnenden<br />
Heimleiters) in Wechselschichten betreut. Untergebracht<br />
wurden schwerpunktmäßig Jugendliche aus Bremen<br />
Nord, Gröpelingen, Walle und Huchting. 345<br />
Konzeptionell hatte man sich um diese Zeit gerade umorientiert.<br />
Um dem unterschiedlichen Tagesrhythmus von Schülern<br />
und Lehrlingen besser Rechnung tragen zu können, wurde die<br />
bisherige Gliederung des Heims nach Altersgruppen zugunsten<br />
einer Gliederung nach Schülern und Berufstätigen aufgegeben.<br />
Beide Gruppen sollten zudem gezielter im schulischen beziehungsweise<br />
beruflichen Bereich gefördert werden. Geplant<br />
wurde, sich künftig verstärkt um die Verselbständigung der<br />
Jugendlichen schon während des Heimaufenthalts zu kümmern.<br />
346 Gleichzeitig wurde allerdings auch betont, dass weder<br />
die organisatorischen noch die personellen Bedingungen ausreichten,<br />
um diese Ziele zu erreichen. Es fehlte noch an baulichen<br />
und personellen Mitteln, um der ȟberwiegenden Fremdversorgung<br />
der Jugendlichen (z.B. Gemeinschaftsküche, Wäsche,<br />
die außerhalb des Hauses gewaschen und gereinigt wird, wirtschaftliche<br />
und finanzielle Versorgung, die für den einzelnen<br />
Jugendlichen nicht durchschaubar ist«) mit einer Alternative zu<br />
begegnen. Eine solche erhoffte man sich von einer Umgestaltung<br />
des dritten Wohnhauses zu einem Haus für Jugendliche<br />
nach der Schulentlassung als »Übungsfeld« für die »Handhabung<br />
alltäglicher Dinge« und zu ihrer weiteren Stabilisierung.<br />
Die Jugendlichen sollten zu diesem Zweck jeweils über ein Einzelzimmer<br />
verfügen, sich selbständig versorgen und lediglich<br />
von einem Sozialarbeiter für Einzelberatung betreut werden. 347<br />
99