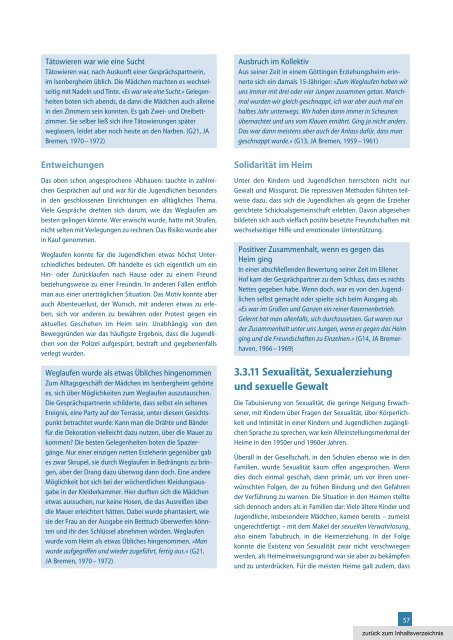1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Tätowieren war wie eine Sucht<br />
Tätowieren war, nach Auskunft einer Gesprächspartnerin,<br />
im Isenbergheim üblich. Die Mädchen machten es wechselseitig<br />
mit Nadeln und Tinte. »Es war wie eine Sucht.« Gelegenheiten<br />
boten sich abends, da dann die Mädchen auch alleine<br />
in den Zimmern sein konnten. Es gab Zwei- und Dreibettzimmer.<br />
Sie selber ließ sich ihre Tätowierungen später<br />
weglasern, leidet aber noch heute an den Narben. (G21, JA<br />
Bremen, 1970 – 1972)<br />
Entweichungen<br />
Das oben schon angesprochene ›Abhauen‹ tauchte in zahlreichen<br />
Gesprächen auf und war für die Jugendlichen besonders<br />
in den geschlossenen Einrichtungen ein alltägliches Thema.<br />
Viele Gespräche drehten sich darum, wie das Weglaufen am<br />
besten gelingen könnte. Wer erwischt wurde, hatte mit Strafen,<br />
nicht selten mit Verlegungen zu rechnen. Das Risiko wurde aber<br />
in Kauf genommen.<br />
Weglaufen konnte für die Jugendlichen etwas höchst Unterschiedliches<br />
bedeuten. Oft handelte es sich eigentlich um ein<br />
Hin- oder Zurücklaufen nach Hause oder zu einem Freund<br />
beziehungsweise zu einer Freundin. In anderen Fällen entfloh<br />
man aus einer unerträglichen Situation. Das Motiv konnte aber<br />
auch Abenteuerlust, der Wunsch, mit anderen etwas zu erleben,<br />
sich vor anderen zu bewähren oder Protest gegen ein<br />
aktuelles Geschehen im Heim sein. Unabhängig von den<br />
Beweggründen war das häufigste Ergebnis, dass die Jugendlichen<br />
von der Polizei aufgespürt, bestraft und gegebenenfalls<br />
verlegt wurden.<br />
Weglaufen wurde als etwas Übliches hingenommen<br />
Zum Alltagsgeschäft der Mädchen im Isenbergheim gehörte<br />
es, sich über Möglichkeiten zum Weglaufen auszutauschen.<br />
Die Gesprächspartnerin schilderte, dass selbst ein seltenes<br />
Ereignis, eine Party auf der Terrasse, unter diesem Gesichtspunkt<br />
betrachtet wurde: Kann man die Drähte und Bänder<br />
für die Dekoration vielleicht dazu nutzen, über die Mauer zu<br />
kommen Die besten Gelegenheiten boten die Spaziergänge.<br />
Nur einer einzigen netten Erzieherin gegenüber gab<br />
es zwar Skrupel, sie durch Weglaufen in Bedrängnis zu bringen,<br />
aber der Drang dazu überwog dann doch. Eine andere<br />
Möglichkeit bot sich bei der wöchentlichen Kleidungsausgabe<br />
in der Kleiderkammer. Hier durften sich die Mädchen<br />
etwas aussuchen, nur keine Hosen, die das Ausreißen über<br />
die Mauer erleichtert hätten. Dabei wurde phantasiert, wie<br />
sie der Frau an der Ausgabe ein Betttuch überwerfen könnten<br />
und ihr den Schlüssel abnehmen würden. Weglaufen<br />
wurde vom Heim als etwas Übliches hingenommen. »Man<br />
wurde aufgegriffen und wieder zugeführt, fertig aus.« (G21,<br />
JA Bremen, 1970 – 1972)<br />
Ausbruch im Kollektiv<br />
Aus seiner Zeit in einem Göttingen Erziehungsheim erinnerte<br />
sich ein damals 15-Jähriger: »Zum Weglaufen haben wir<br />
uns immer mit drei oder vier Jungen zusammen getan. Manchmal<br />
wurden wir gleich geschnappt, ich war aber auch mal ein<br />
halbes Jahr unterwegs. Wir haben dann immer in Scheunen<br />
übernachtet und uns vom Klauen ernährt. Ging ja nicht anders.<br />
Das war dann meistens aber auch der Anlass dafür, dass man<br />
geschnappt wurde.« (G13, JA Bremen, 1959 – 1961)<br />
Solidarität im Heim<br />
Unter den Kindern und Jugendlichen herrschten nicht nur<br />
Gewalt und Missgunst. Die repressiven Methoden führten teilweise<br />
dazu, dass sich die Jugendlichen als gegen die Erzieher<br />
gerichtete Schicksalsgemeinschaft erlebten. Davon abgesehen<br />
bildeten sich auch vielfach positiv besetzte Freundschaften mit<br />
wechselseitiger Hilfe und emotionaler Unterstützung.<br />
Positiver Zusammenhalt, wenn es gegen das<br />
Heim ging<br />
In einer abschließenden Bewertung seiner Zeit im Ellener<br />
Hof kam der Gesprächpartner zu dem Schluss, dass es nichts<br />
Nettes gegeben habe. Wenn doch, war es von den Jugend -<br />
lichen selbst gemacht oder spielte sich beim Ausgang ab.<br />
»Es war im Großen und Ganzen ein reiner Kasernenbetrieb.<br />
Gelernt hat man allenfalls, sich durchzusetzen. Gut waren nur<br />
der Zusammenhalt unter uns Jungen, wenn es gegen das Heim<br />
ging und die Freundschaften zu Einzelnen.« (G14, JA Bremerhaven,<br />
1966 – 1969)<br />
3.3.11 Sexualität, Sexualerziehung<br />
und sexuelle Gewalt<br />
Die Tabuisierung von Sexualität, die geringe Neigung Erwachsener,<br />
mit Kindern über Fragen der Sexualität, über Körperlichkeit<br />
und Intimität in einer Kindern und Jugendlichen zugänglichen<br />
Sprache zu sprechen, war kein Alleinstellungsmerkmal der<br />
Heime in den 1950er und 1960er Jahren.<br />
Überall in der Gesellschaft, in den Schulen ebenso wie in den<br />
Familien, wurde Sexualität kaum offen angesprochen. Wenn<br />
dies doch einmal geschah, dann primär, um vor ihren unerwünschten<br />
Folgen, der zu frühen Bindung und den Gefahren<br />
der Verführung zu warnen. Die Situation in den Heimen stellte<br />
sich dennoch anders als in Familien dar: Viele ältere Kinder und<br />
Jugendliche, insbesondere Mädchen, kamen bereits – zumeist<br />
ungerechtfertigt – mit dem Makel der sexuellen Verwahrlosung,<br />
also einem Tabubruch, in die Heimerziehung. In der Folge<br />
konnte die Existenz von Sexualität zwar nicht verschwiegen<br />
werden, als Heimeinweisungsgrund war sie aber zu bekämpfen<br />
und zu unterdrücken. Für die meisten Heime galt zudem, dass<br />
57