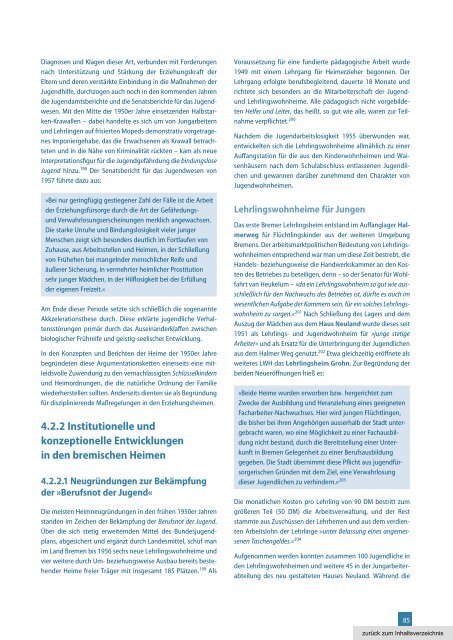1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diagnosen und Klagen dieser Art, verbunden mit Forderungen<br />
nach Unterstützung und Stärkung der Erziehungskraft der<br />
Eltern und deren verstärkte Einbindung in die Maßnahmen der<br />
Jugendhilfe, durchzogen auch noch in den kommenden Jahren<br />
die Jugendamtsberichte und die Senatsberichte für das Jugendwesen.<br />
Mit den Mitte der 1950er Jahre einsetzenden Halbstarken-Krawallen<br />
– dabei handelte es sich um von Jungarbeitern<br />
und Lehrlingen auf frisierten Mopeds demonstrativ vorgetragenes<br />
Imponiergehabe, das die Erwachsenen als Krawall betrachteten<br />
und in die Nähe von Kriminalität rückten – kam als neue<br />
Interpretationsfigur für die Jugendgefährdung die bindungslose<br />
Jugend hinzu. 198 Der Senatsbericht für das Jugendwesen von<br />
1957 führte dazu aus:<br />
»Bei nur geringfügig gestiegener Zahl der Fälle ist die Arbeit<br />
der Erziehungsfürsorge durch die Art der Gefährdungsund<br />
Verwahrlosungserscheinungen merklich angewachsen.<br />
Die starke Unruhe und Bindungslosigkeit vieler junger<br />
Menschen zeigt sich besonders deutlich im Fortlaufen von<br />
Zuhause, aus Arbeitsstellen und Heimen, in der Schließung<br />
von Frühehen bei mangelnder menschlicher Reife und<br />
äußerer Sicherung, in vermehrter heimlicher Prostitution<br />
sehr junger Mädchen, in der Hilflosigkeit bei der Erfüllung<br />
der eigenen Freizeit.«<br />
Am Ende dieser Periode setzte sich schließlich die sogenannte<br />
Akkzelerationsthese durch. Diese erklärte jugendliche Verhaltensstörungen<br />
primär durch das Auseinanderklaffen zwischen<br />
biologischer Frühreife und geistig-seelischer Entwicklung.<br />
In den Konzepten und Berichten der Heime der 1950er Jahre<br />
begründeten diese Argumentationsketten einerseits eine mitleidsvolle<br />
Zuwendung zu den vernachlässigten Schlüsselkindern<br />
und Heimordnungen, die die natürliche Ordnung der Familie<br />
wiederherstellen sollten. Anderseits dienten sie als Begründung<br />
für disziplinierende Maßregelungen in den Erziehungsheimen.<br />
4.2.2 Institutionelle und<br />
konzeptionelle Entwicklungen<br />
in den bremischen Heimen<br />
4.2.2.1 Neugründungen zur Bekämpfung<br />
der »Berufsnot der Jugend«<br />
Die meisten Heimneugründungen in den frühen 1950er Jahren<br />
standen im Zeichen der Bekämpfung der Berufsnot der Jugend.<br />
Über die sich stetig erweiternden Mittel des Bundesjugendplans,<br />
abgesichert und ergänzt durch Landesmittel, schuf man<br />
im Land Bremen bis 1956 sechs neue Lehrlingswohnheime und<br />
vier weitere durch Um- beziehungsweise Ausbau bereits bestehender<br />
Heime freier Träger mit insgesamt 185 Plätzen. 199 Als<br />
Voraussetzung für eine fundierte pädagogische Arbeit wurde<br />
1949 mit einem Lehrgang für Heimerzieher begonnen. Der<br />
Lehrgang erfolgte berufsbegleitend, dauerte 18 Monate und<br />
richtete sich besonders an die Mitarbeiterschaft der Jugendund<br />
Lehrlingswohnheime. Alle pädagogisch nicht vorgebildeten<br />
Helfer und Leiter, das heißt, so gut wie alle, waren zur Teilnahme<br />
verpflichtet. 200<br />
Nachdem die Jugendarbeitslosigkeit 1955 überwunden war,<br />
entwickelten sich die Lehrlingswohnheime allmählich zu einer<br />
Auffangstation für die aus den Kinderwohnheimen und Waisenhäusern<br />
nach dem Schulabschluss entlassenen Jugendlichen<br />
und gewannen darüber zunehmend den Charakter von<br />
Jugendwohnheimen.<br />
Lehrlingswohnheime für Jungen<br />
Das erste Bremer Lehrlingsheim entstand im Auffanglager Halmerweg<br />
für Flüchtlingskinder aus der weiteren Umgebung<br />
Bremens. Der arbeitsmarktpolitischen Bedeutung von Lehrlingswohnheimen<br />
entsprechend war man um diese Zeit bestrebt, die<br />
Handels- beziehungsweise die Handwerkskammer an den Kosten<br />
des Betriebes zu beteiligen, denn – so der Senator für Wohlfahrt<br />
van Heukelum – »da ein Lehrlingswohnheim so gut wie ausschließlich<br />
für den Nachwuchs des Betriebes ist, dürfte es auch im<br />
wesentlichen Aufgabe der Kammern sein, für ein solches Lehrlingswohnheim<br />
zu sorgen.« 201 Nach Schließung des Lagers und dem<br />
Auszug der Mädchen aus dem Haus Neuland wurde dieses seit<br />
1951 als Lehrlings- und Jugendwohnheim für »junge stetige<br />
Arbeiter« und als Ersatz für die Unterbringung der Jugendlichen<br />
aus dem Halmer Weg genutzt. 202 Etwa gleichzeitig eröffnete als<br />
weiteres LWH das Lehrlingsheim Grohn. Zur Begründung der<br />
beiden Neueröffnungen hieß es:<br />
»Beide Heime wurden erworben bzw. hergerichtet zum<br />
Zwecke der Ausbildung und Heranziehung eines geeigneten<br />
Facharbeiter-Nachwuchses. Hier wird jungen Flüchtlingen,<br />
die bisher bei ihren Angehörigen ausserhalb der Stadt untergebracht<br />
waren, wo eine Möglichkeit zu einer Fachausbildung<br />
nicht bestand, durch die Bereitstellung einer Unterkunft<br />
in Bremen Gelegenheit zu einer Berufsausbildung<br />
gegeben. Die Stadt übernimmt diese Pflicht aus jugendfürsorgerischen<br />
Gründen mit dem Ziel, eine Verwahrlosung<br />
dieser Jugendlichen zu verhindern.« 203<br />
Die monatlichen Kosten pro Lehrling von 90 DM bestritt zum<br />
größeren Teil (50 DM) die Arbeitsverwaltung, und der Rest<br />
stammte aus Zuschüssen der Lehrherren und aus dem verdienten<br />
Arbeitslohn der Lehrlinge »unter Belassung eines angemessenen<br />
Taschengeldes.« 204<br />
Aufgenommen werden konnten zusammen 100 Jugendliche in<br />
den Lehrlingswohnheimen und weitere 45 in der Jungarbeiterabteilung<br />
des neu gestalteten Hauses Neuland. Während die<br />
85