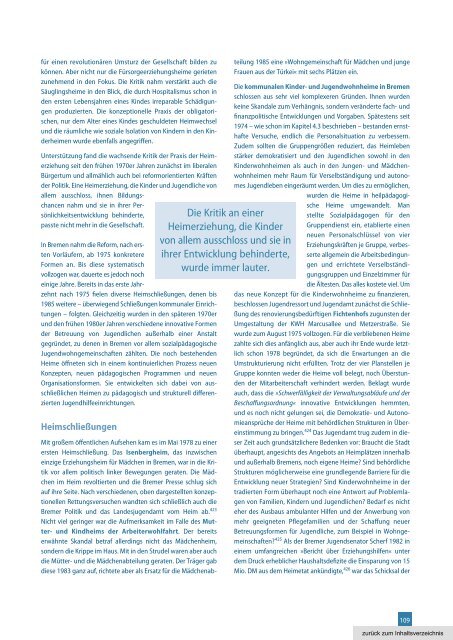1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
für einen revolutionären Umsturz der Gesellschaft bilden zu<br />
können. Aber nicht nur die Fürsorgeerziehungsheime gerieten<br />
zunehmend in den Fokus. Die Kritik nahm verstärkt auch die<br />
Säuglingsheime in den Blick, die durch Hospitalismus schon in<br />
den ersten Lebensjahren eines Kindes irreparable Schädigungen<br />
produzierten. Die konzeptionelle Praxis der obligatorischen,<br />
nur dem Alter eines Kindes geschuldeten Heimwechsel<br />
und die räumliche wie soziale Isolation von Kindern in den Kinderheimen<br />
wurde ebenfalls angegriffen.<br />
Unterstützung fand die wachsende Kritik der Praxis der Heimerziehung<br />
seit den frühen 1970er Jahren zunächst im liberalen<br />
Bürgertum und allmählich auch bei reformorientierten Kräften<br />
der Politik. Eine Heimerziehung, die Kinder und Jugendliche von<br />
allem ausschloss, ihnen Bildungschancen<br />
nahm und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung<br />
behinderte,<br />
passte nicht mehr in die Gesellschaft.<br />
In Bremen nahm die Reform, nach ersten<br />
Vorläufern, ab 1975 konkretere<br />
Formen an. Bis diese systematisch<br />
vollzogen war, dauerte es jedoch noch<br />
einige Jahre. Bereits in das erste Jahrzehnt<br />
nach 1975 fielen diverse Heimschließungen, denen bis<br />
1985 weitere – überwiegend Schließungen kommunaler Einrichtungen<br />
– folgten. Gleichzeitig wurden in den späteren 1970er<br />
und den frühen 1980er Jahren verschiedene innovative Formen<br />
der Betreuung von Jugendlichen außerhalb einer Anstalt<br />
gegründet, zu denen in Bremen vor allem sozialpädagogische<br />
Jugendwohngemeinschaften zählten. Die noch bestehenden<br />
Heime öffneten sich in einem kontinuierlichen Prozess neuen<br />
Konzepten, neuen pädagogischen Programmen und neuen<br />
Organisationsformen. Sie entwickelten sich dabei von ausschließlichen<br />
Heimen zu pädagogisch und strukturell differenzierten<br />
Jugendhilfeeinrichtungen.<br />
Heimschließungen<br />
Mit großem öffentlichen Aufsehen kam es im Mai 1978 zu einer<br />
ersten Heimschließung. Das Isenbergheim, das inzwischen<br />
einzige Erziehungsheim für Mädchen in Bremen, war in die Kritik<br />
vor allem politisch linker Bewegungen geraten. Die Mädchen<br />
im Heim revoltierten und die Bremer Presse schlug sich<br />
auf ihre Seite. Nach verschiedenen, oben dargestellten konzeptionellen<br />
Rettungsversuchen wandten sich schließlich auch die<br />
Bremer Politik und das Landesjugendamt vom Heim ab. 423<br />
Nicht viel geringer war die Aufmerksamkeit im Falle des Mutter-<br />
und Kindheims der Arbeiterwohlfahrt. Der bereits<br />
erwähnte Skandal betraf allerdings nicht das Mädchenheim,<br />
sondern die Krippe im Haus. Mit in den Strudel waren aber auch<br />
die Mütter- und die Mädchenabteilung geraten. Der Träger gab<br />
diese 1983 ganz auf, richtete aber als Ersatz für die Mädchenabteilung<br />
1985 eine »Wohngemeinschaft für Mädchen und junge<br />
Frauen aus der Türkei« mit sechs Plätzen ein.<br />
Die kommunalen Kinder- und Jugendwohnheime in Bremen<br />
schlossen aus sehr viel komplexeren Gründen. Ihnen wurden<br />
keine Skandale zum Verhängnis, sondern veränderte fach- und<br />
finanzpolitische Entwicklungen und Vorgaben. Spätestens seit<br />
1974 – wie schon im Kapitel 4.3 beschrieben – bestanden ernsthafte<br />
Versuche, endlich die Personalsituation zu verbessern.<br />
Zudem sollten die Gruppengrößen reduziert, das Heimleben<br />
stärker demokratisiert und den Jugendlichen sowohl in den<br />
Kinderwohnheimen als auch in den Jungen- und Mädchenwohnheimen<br />
mehr Raum für Verselbständigung und autonomes<br />
Jugendleben eingeräumt werden. Um dies zu ermöglichen,<br />
wurden die Heime in heilpädagogische<br />
Heime umgewandelt. Man<br />
Die Kritik an einer<br />
stellte Sozialpädagogen für den<br />
Heimerziehung, die Kinder Gruppendienst ein, etablierte einen<br />
neuen Personalschlüssel von vier<br />
von allem ausschloss und sie in<br />
Erziehungskräften je Gruppe, verbesserte<br />
allgemein die Arbeitsbedingun-<br />
ihrer Entwicklung behinderte,<br />
gen und errichtete Verselbständigungsgruppen<br />
und Einzelzimmer für<br />
wurde immer lauter.<br />
die Ältesten. Das alles kostete viel. Um<br />
das neue Konzept für die Kinderwohnheime zu finanzieren,<br />
beschlossen Jugendressort und Jugendamt zunächst die Schließung<br />
des renovierungsbedürftigen Fichtenhofs zugunsten der<br />
Umgestaltung der KWH Marcusallee und Metzerstraße. Sie<br />
wurde zum August 1975 vollzogen. Für die verbliebenen Heime<br />
zahlte sich dies anfänglich aus, aber auch ihr Ende wurde letztlich<br />
schon 1978 begründet, da sich die Erwartungen an die<br />
Umstrukturierung nicht erfüllten. Trotz der vier Planstellen je<br />
Gruppe konnten weder die Heime voll belegt, noch Überstunden<br />
der Mitarbeiterschaft verhindert werden. Beklagt wurde<br />
auch, dass die »Schwerfälligkeit der Verwaltungsabläufe und der<br />
Beschaffungsordnung« innovative Entwicklungen hemmten,<br />
und es noch nicht gelungen sei, die Demokratie- und Autonomieansprüche<br />
der Heime mit behördlichen Strukturen in Übereinstimmung<br />
zu bringen. 424 Das Jugendamt trug zudem in dieser<br />
Zeit auch grundsätzlichere Bedenken vor: Braucht die Stadt<br />
überhaupt, angesichts des Angebots an Heimplätzen innerhalb<br />
und außerhalb Bremens, noch eigene Heime Sind behördliche<br />
Strukturen möglicherweise eine grundlegende Barriere für die<br />
Entwicklung neuer Strategien Sind Kinderwohnheime in der<br />
tradierten Form überhaupt noch eine Antwort auf Problemlagen<br />
von Familien, Kindern und Jugendlichen Bedarf es nicht<br />
eher des Ausbaus ambulanter Hilfen und der Anwerbung von<br />
mehr geeigneten Pflegefamilien und der Schaffung neuer<br />
Betreuungsformen für Jugendliche, zum Beispiel in Wohngemeinschaften<br />
425 Als der Bremer Jugendsenator Scherf 1982 in<br />
einem umfangreichen »Bericht über Erziehungshilfen« unter<br />
dem Druck erheblicher Haushaltsdefizite die Einsparung von 15<br />
Mio. DM aus dem Heimetat ankündigte, 426 war das Schicksal der<br />
109