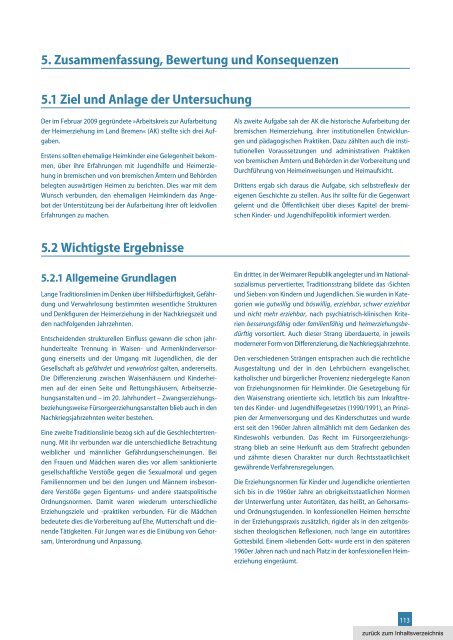1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5. Zusammenfassung, Bewertung und Konsequenzen<br />
5.1 Ziel und Anlage der Untersuchung<br />
Der im Februar 2009 gegründete »Arbeitskreis zur Aufarbeitung<br />
der Heimerziehung im Land Bremen« (AK) stellte sich drei Aufgaben.<br />
Erstens sollten ehemalige Heimkinder eine Gelegenheit bekommen,<br />
über ihre Erfahrungen mit Jugendhilfe und Heimerziehung<br />
in bremischen und von bremischen Ämtern und Behörden<br />
belegten auswärtigen Heimen zu berichten. Dies war mit dem<br />
Wunsch verbunden, den ehemaligen Heimkindern das Angebot<br />
der Unterstützung bei der Aufarbeitung ihrer oft leidvollen<br />
Erfahrungen zu machen.<br />
Als zweite Aufgabe sah der AK die historische Aufarbeitung der<br />
bremischen Heimerziehung, ihrer institutionellen Entwicklungen<br />
und pädagogischen Praktiken. Dazu zählten auch die institutionellen<br />
Voraussetzungen und administrativen Praktiken<br />
von bremischen Ämtern und Behörden in der Vorbereitung und<br />
Durchführung von Heimeinweisungen und Heimaufsicht.<br />
Drittens ergab sich daraus die Aufgabe, sich selbstreflexiv der<br />
eigenen Geschichte zu stellen. Aus ihr sollte für die Gegenwart<br />
gelernt und die Öffentlichkeit über dieses Kapitel der bremischen<br />
Kinder- und Jugendhilfepolitik informiert werden.<br />
5.2 Wichtigste Ergebnisse<br />
5.2.1 Allgemeine Grundlagen<br />
Lange Traditionslinien im Denken über Hilfsbedürftigkeit, Gefährdung<br />
und Verwahrlosung bestimmten wesentliche Strukturen<br />
und Denkfiguren der Heimerziehung in der Nachkriegszeit und<br />
den nachfolgenden Jahrzehnten.<br />
Entscheidenden strukturellen Einfluss gewann die schon jahrhundertealte<br />
Trennung in Waisen- und Armenkinderversorgung<br />
einerseits und der Umgang mit Jugendlichen, die der<br />
Gesellschaft als gefährdet und verwahrlost galten, andererseits.<br />
Die Differenzierung zwischen Waisenhäusern und Kinderheimen<br />
auf der einen Seite und Rettungshäusern, Arbeitserziehungsanstalten<br />
und – im 20. Jahrhundert – Zwangserziehungsbeziehungsweise<br />
Fürsorgeerziehungsanstalten blieb auch in den<br />
Nachkriegsjahrzehnten weiter bestehen.<br />
Eine zweite Traditionslinie bezog sich auf die Geschlechtertrennung.<br />
Mit ihr verbunden war die unterschiedliche Betrachtung<br />
weiblicher und männlicher Gefährdungserscheinungen. Bei<br />
den Frauen und Mädchen waren dies vor allem sanktionierte<br />
gesellschaftliche Verstöße gegen die Sexualmoral und gegen<br />
Familiennormen und bei den Jungen und Männern insbesondere<br />
Verstöße gegen Eigentums- und andere staatspolitische<br />
Ordnungsnormen. Damit waren wiederum unterschiedliche<br />
Erziehungsziele und -praktiken verbunden. Für die Mädchen<br />
bedeutete dies die Vorbereitung auf Ehe, Mutterschaft und dienende<br />
Tätigkeiten. Für Jungen war es die Einübung von Gehorsam,<br />
Unterordnung und Anpassung.<br />
Ein dritter, in der Weimarer Republik angelegter und im Nationalsozialismus<br />
pervertierter, Traditionsstrang bildete das ›Sichten<br />
und Sieben‹ von Kindern und Jugendlichen. Sie wurden in Kategorien<br />
wie gutwillig und böswillig, erziehbar, schwer erziehbar<br />
und nicht mehr erziehbar, nach psychiatrisch-klinischen Kriterien<br />
besserungsfähig oder familienfähig und heimerziehungsbedürftig<br />
vorsortiert. Auch dieser Strang überdauerte, in jeweils<br />
modernerer Form von Differenzierung, die Nachkriegsjahrzehnte.<br />
Den verschiedenen Strängen entsprachen auch die rechtliche<br />
Ausgestaltung und der in den Lehrbüchern evangelischer,<br />
katholischer und bürgerlicher Provenienz niedergelegte Kanon<br />
von Erziehungsnormen für Heimkinder. Die Gesetzgebung für<br />
den Waisenstrang orientierte sich, letztlich bis zum Inkrafttreten<br />
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (1990/1991), an Prinzipien<br />
der Armenversorgung und des Kinderschutzes und wurde<br />
erst seit den 1960er Jahren allmählich mit dem Gedanken des<br />
Kindeswohls verbunden. Das Recht im Fürsorgeerziehungsstrang<br />
blieb an seine Herkunft aus dem Strafrecht gebunden<br />
und zähmte diesen Charakter nur durch Rechtsstaatlichkeit<br />
gewährende Verfahrensregelungen.<br />
Die Erziehungsnormen für Kinder und Jugendliche orientierten<br />
sich bis in die 1960er Jahre an obrigkeitsstaatlichen Normen<br />
der Unterwerfung unter Autoritäten, das heißt, an Gehorsamsund<br />
Ordnungstugenden. In konfessionellen Heimen herrschte<br />
in der Erziehungspraxis zusätzlich, rigider als in den zeitgenössischen<br />
theologischen Reflexionen, noch lange ein autoritäres<br />
Gottesbild. Einem »liebenden Gott« wurde erst in den späteren<br />
1960er Jahren nach und nach Platz in der konfessionellen Heimerziehung<br />
eingeräumt.<br />
113