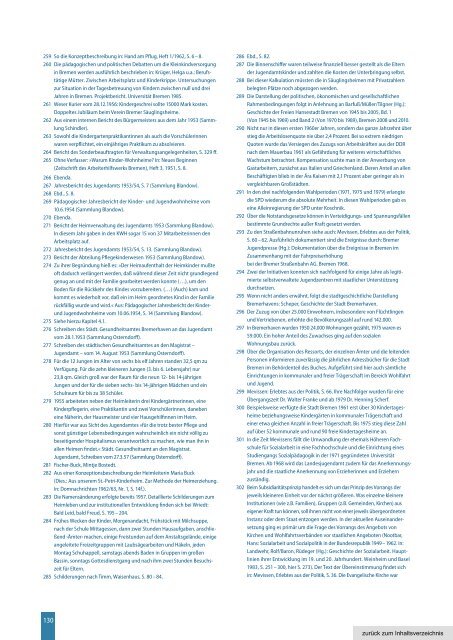1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
259 So die Konzeptbeschreibung in: Hand am Pflug, Heft 1/1962, S. 6 – 8.<br />
260 Die pädagogischen und politischen Debatten um die Kleinkindversorgung<br />
in Bremen werden ausführlich beschrieben in: Krüger, Helga u.a.: Berufstätige<br />
Mütter. Zwischen Arbeitsplatz und Kinderkrippe. Untersuchungen<br />
zur Situation in der Tagesbetreuung von Kindern zwischen null und drei<br />
Jahren in Bremen. Projektbericht. Universität Bremen 1985.<br />
261 Weser Kurier vom 28.12.1956: Kindergeschrei sollte 15000 Mark kosten.<br />
Doppeltes Jubiläum beim Verein Bremer Säuglingsheime.<br />
262 Aus einem internen Bericht des Bürgermeisters aus dem Jahr 1953 (Sammlung<br />
Schindler).<br />
263 Sowohl die Kindergartenpraktikantinnen als auch die Vorschülerinnen<br />
waren verpflichtet, ein einjähriges Praktikum zu absolvieren.<br />
264 Bericht des Sonderbeauftragten für Verwaltungsangelegenheiten, S. 329 ff.<br />
265 Ohne Verfasser: »Warum Kinder-Wohnheime In: Neues Beginnen<br />
(Zeitschrift des Arbeiterhilfswerks Bremen), Heft 3, 1951, S. 8.<br />
266 Ebenda.<br />
267 Jahresbericht des Jugendamts 1953/54, S. 7 (Sammlung Blandow).<br />
268 Ebd., S. 8.<br />
269 Pädagogischer Jahresbericht der Kinder- und Jugendwohnheime vom<br />
10.6.1954 (Sammlung Blandow).<br />
270 Ebenda.<br />
271 Bericht der Heimverwaltung des Jugendamts 1953 (Sammlung Blandow).<br />
In diesem Jahr gaben in den KWH sogar 15 von 37 Mitarbeiterinnen den<br />
Arbeitsplatz auf.<br />
272 Jahresbericht des Jugendamts 1953/54, S. 13. (Sammlung Blandow).<br />
273 Bericht der Abteilung Pflegekinderwesen 1953 (Sammlung Blandow).<br />
274 Zu ihrer Begründung hieß es: »Der Heimaufenthalt der Heimkinder mußte<br />
oft dadurch verlängert werden, daß während dieser Zeit nicht grundlegend<br />
genug an und mit der Familie gearbeitet werden konnte (…), um den<br />
Boden für die Rückkehr des Kindes vorzubereiten. (…) (Auch) kam und<br />
kommt es wiederholt vor, daß ein im Heim geordnetes Kind in der Familie<br />
rückfällig wurde und wird.« Aus: Pädagogischer Jahresbericht der Kinderund<br />
Jugendwohnheime vom 10.06.1954, S. 14 (Sammlung Blandow).<br />
275 Siehe hierzu Kapitel 4.1.<br />
276 Schreiben des Städt. Gesundheitsamtes Bremerhaven an das Jugendamt<br />
vom 28.1.1953 (Sammlung Osterndorff).<br />
277 Schreiben des städtischen Gesundheitsamtes an den Magistrat –<br />
Jugendamt – vom 14. August 1953 (Sammlung Osterndorff).<br />
278 Für die 12 Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren standen 32,5 qm zu<br />
Verfügung. Für die zehn kleineren Jungen (3. bis 6. Lebensjahr) nur<br />
23,8 qm. Gleich groß war der Raum für die neun 12- bis 14-jährigen<br />
Jungen und der für die sieben sechs- bis 14-jährigen Mädchen und ein<br />
Schulraum für bis zu 38 Schüler.<br />
279 1955 arbeiteten neben der Heimleiterin drei Kindergärtnerinnen, eine<br />
Kinderpflegerin, eine Praktikantin und zwei Vorschülerinnen, daneben<br />
eine Näherin, der Hausmeister und vier Hausgehilfinnen im Heim.<br />
280 Hierfür war aus Sicht des Jugendamtes »für die trotz bester Pflege und<br />
sonst günstiger Lebensbedingungen wahrscheinlich ein nicht völlig zu<br />
beseitigender Hospitalismus verantwortlich zu machen, wie man ihn in<br />
allen Heimen findet.« Städt. Gesundheitsamt an den Magistrat.<br />
Jugendamt, Schreiben vom 27.3.57 (Sammlung Osterndorff).<br />
281 Fischer-Buck, Mintje Bostedt.<br />
282 Aus einer Konzeptionsbeschreibung der Heimleiterin Maria Buck<br />
(Dies.: Aus unserem St.-Petri-Kinderheim. Zur Methode der Heim erziehung.<br />
In: Domnachrichten 1962/63, Nr. 1, S. 14f.).<br />
283 Die Namensänderung erfolgte bereits 1957. Detaillierte Schilderungen zum<br />
Heimleben und zur institutionellen Entwicklung finden sich bei Wriedt:<br />
Bald Leid, bald Freud, S. 195 – 204.<br />
284 Frühes Wecken der Kinder, Morgenandacht, Frühstück mit Milchsuppe,<br />
nach der Schule Mittagessen, dann zwei Stunden Hausaufgaben, anschließend<br />
›Ämter‹ machen, einige Freistunden auf dem Anstaltsgelände, einige<br />
angeleitete Freizeitgruppen mit Laubsägearbeiten und Häkeln, jeden<br />
Montag Schuhappell, samstags abends Baden in Gruppen im großen<br />
Bassin, sonntags Gottesdienstgang und nach ihm zwei Stunden Besuchszeit<br />
für Eltern.<br />
285 Schilderungen nach Timm, Waisenhaus, S. 80 – 84.<br />
286 Ebd., S. 82.<br />
287 Die Binnenschiffer waren teilweise finanziell besser gestellt als die Eltern<br />
der Jugendamtskinder und zahlten die Kosten der Unterbringung selbst.<br />
288 Bei dieser Kalkulation müssten die in Säuglingsheimen mit Privatzahlern<br />
belegten Plätze noch abgezogen werden.<br />
289 Die Darstellung der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen folgt in Anlehnung an Barfuß/Müller/Tilgner (Hg.):<br />
Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005, Bd. 1<br />
(Von 1945 bis 1969) und Band 2 (Von 1970 bis 1989), Bremen 2008 und 2010.<br />
290 Nicht nur in diesen ersten 1960er Jahren, sondern das ganze Jahrzehnt über<br />
stieg die Arbeitslosenquote nie über 2,4 Prozent. Bei so extrem niedrigen<br />
Quoten wurde das Versiegen des Zuzugs von Arbeitskräften aus der DDR<br />
nach dem Mauerbau 1961 als Gefährdung für weiteres wirtschaftliches<br />
Wachstum betrachtet. Kompensation suchte man in der Anwerbung von<br />
Gastarbeitern, zunächst aus Italien und Griechenland. Deren Anteil an allen<br />
Beschäftigten blieb in der Ära Kaisen mit 2,1 Prozent aber geringer als in<br />
vergleichbaren Großstädten.<br />
291 In den drei nachfolgenden Wahlperioden (1971, 1975 und 1979) erlangte<br />
die SPD wiederum die absolute Mehrheit. In diesen Wahlperioden gab es<br />
eine Alleinregierung der SPD unter Koschnik.<br />
292 Über die Notstandsgesetze können in Verteidigungs- und Spannungsfällen<br />
bestimmte Grundrechte außer Kraft gesetzt werden.<br />
293 Zu den Straßenbahnunruhen siehe auch: Mevissen, Erlebtes aus der Politik,<br />
S. 60 – 62. Ausführlich dokumentiert sind die Ereignisse durch: Bremer<br />
Jugendpresse (Hg.): Dokumentation über die Ereignisse in Bremen im<br />
Zusammenhang mit der Fahrpreiserhöhung<br />
bei der Bremer Straßenbahn AG. Bremen 1968.<br />
294 Zwei der Initiativen konnten sich nachfolgend für einige Jahre als legitimierte<br />
selbstverwaltete Jugendzentren mit staatlicher Unterstützung<br />
durchsetzen.<br />
295 Wenn nicht anders erwähnt, folgt die stadtgeschichtliche Darstellung<br />
Bremerhavens: Scheper, Geschichte der Stadt Bremerhaven.<br />
296 Der Zuzug von über 25.000 Einwohnern, insbesondere von Flüchtlingen<br />
und Vertriebenen, erhöhte die Bevölkerungszahl auf rund 142.000.<br />
297 In Bremerhaven wurden 1950 24.000 Wohnungen gezählt, 1975 waren es<br />
59.000. Ein hoher Anteil des Zuwachses ging auf den sozialen<br />
Wohnungsbau zurück.<br />
298 Über die Organisation des Ressorts, der einzelnen Ämter und die leitenden<br />
Personen informieren zuverlässig die jährlichen Adressbücher für die Stadt<br />
Bremen im Behördenteil des Buches. Aufgeführt sind hier auch sämtliche<br />
Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft im Bereich Wohlfahrt<br />
und Jugend.<br />
299 Mevissen: Erlebtes aus der Politik, S. 66. Ihre Nachfolger wurden für eine<br />
Übergangszeit Dr. Walter Franke und ab 1979 Dr. Henning Scherf.<br />
300 Beispielsweise verfügte die Stadt Bremen 1961 erst über 30 Kindertagesheime<br />
beziehungsweise Kindergärten in kommunaler Trägerschaft und<br />
einer etwa gleichen Anzahl in freier Trägerschaft. Bis 1975 stieg diese Zahl<br />
auf über 52 kommunale und rund 90 freie Kinder tagesheime an.<br />
301 In die Zeit Mevissens fällt die Umwandlung der ehemals Höheren Fachschule<br />
für Sozialarbeit in eine Fachhochschule und die Einrichtung eines<br />
Studiengangs Sozialpädagogik in der 1971 gegründeten Universität<br />
Bremen. Ab 1968 wird das Landesjugendamt zudem für das Anerkennungsjahr<br />
und die staatliche Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern<br />
zuständig.<br />
302 Beim Subsidiaritätsprinzip handelt es sich um das Prinzip des Vorrangs der<br />
jeweils kleineren Einheit vor der nächst größeren. Was einzelne kleinere<br />
Institutionen (wie z.B. Familien), Gruppen (z.B. Gemeinden, Kirchen) aus<br />
eigener Kraft tun können, soll ihnen nicht von einer jeweils übergeordneten<br />
Instanz oder dem Staat entzogen werden. In der aktuellen Auseinandersetzung<br />
ging es primär um die Frage des Vorrangs des Angebots von<br />
Kirchen und Wohlfahrtsverbänden vor staatlichen Angeboten (Nootbar,<br />
Hans: Sozialarbeit und Sozialpolitik in der Bundesrepublik 1949 – 1962. In:<br />
Landwehr, Rolf/Baron, Rüdeger (Hg.): Geschichte der Sozialarbeit. Hauptlinien<br />
ihrer Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Weinheim und Basel<br />
1983, S. 251 – 300, hier S. 273). Der Text der Übereinstimmung findet sich<br />
in: Mevissen, Erlebtes aus der Politik, S. 36. Die Evangelische Kirche war<br />
130