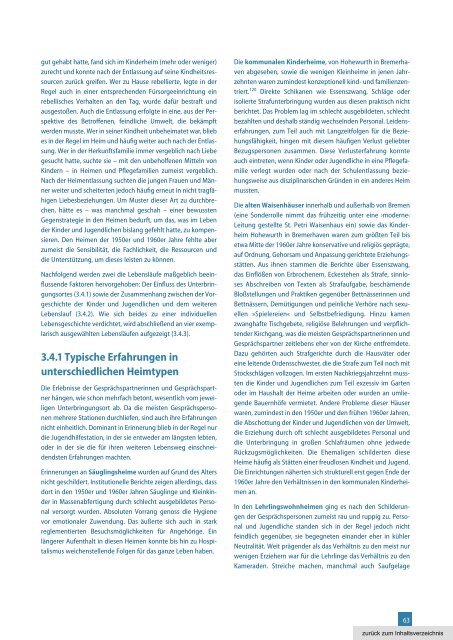1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gut gehabt hatte, fand sich im Kinderheim (mehr oder weniger)<br />
zurecht und konnte nach der Entlassung auf seine Kindheitsressourcen<br />
zurück greifen. Wer zu Hause rebellierte, legte in der<br />
Regel auch in einer entsprechenden Fürsorgeeinrichtung ein<br />
rebellisches Verhalten an den Tag, wurde dafür bestraft und<br />
ausgestoßen. Auch die Entlassung erfolgte in eine, aus der Perspektive<br />
des Betroffenen, feindliche Umwelt, die bekämpft<br />
werden musste. Wer in seiner Kindheit unbeheimatet war, blieb<br />
es in der Regel im Heim und häufig weiter auch nach der Entlassung.<br />
Wer in der Herkunftsfamilie immer vergeblich nach Liebe<br />
gesucht hatte, suchte sie – mit den unbeholfenen Mitteln von<br />
Kindern – in Heimen und Pflegefamilien zumeist vergeblich.<br />
Nach der Heimentlassung suchten die jungen Frauen und Männer<br />
weiter und scheiterten jedoch häufig erneut in nicht tragfähigen<br />
Liebesbeziehungen. Um Muster dieser Art zu durchbrechen,<br />
hätte es – was manchmal geschah – einer bewussten<br />
Gegenstrategie in den Heimen bedurft, um das, was im Leben<br />
der Kinder und Jugendlichen bislang gefehlt hatte, zu kompensieren.<br />
Den Heimen der 1950er und 1960er Jahre fehlte aber<br />
zumeist die Sensibilität, die Fachlichkeit, die Ressourcen und<br />
die Unterstützung, um dieses leisten zu können.<br />
Nachfolgend werden zwei die Lebensläufe maßgeblich beeinflussende<br />
Faktoren hervorgehoben: Der Einfluss des Unterbringungsortes<br />
(3.4.1) sowie der Zusammenhang zwischen der Vorgeschichte<br />
der Kinder und Jugendlichen und dem weiteren<br />
Lebenslauf (3.4.2). Wie sich beides zu einer individuellen<br />
Lebensgeschichte verdichtet, wird abschließend an vier exemplarisch<br />
ausgewählten Lebensläufen aufgezeigt (3.4.3).<br />
3.4.1 Typische Erfahrungen in<br />
unterschiedlichen Heimtypen<br />
Die Erlebnisse der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner<br />
hängen, wie schon mehrfach betont, wesentlich vom jeweiligen<br />
Unterbringungsort ab. Da die meisten Gesprächspersonen<br />
mehrere Stationen durchliefen, sind auch ihre Erfahrungen<br />
nicht einheitlich. Dominant in Erinnerung blieb in der Regel nur<br />
die Jugendhilfestation, in der sie entweder am längsten lebten,<br />
oder in der sie die für ihren weiteren Lebensweg einschneidendsten<br />
Erfahrungen machten.<br />
Erinnerungen an Säuglingsheime wurden auf Grund des Alters<br />
nicht geschildert. Institutionelle Berichte zeigen allerdings, dass<br />
dort in den 1950er und 1960er Jahren Säuglinge und Kleinkinder<br />
in Massenabfertigung durch schlecht ausgebildetes Personal<br />
versorgt wurden. Absoluten Vorrang genoss die Hygiene<br />
vor emotionaler Zuwendung. Das äußerte sich auch in stark<br />
reglementierten Besuchsmöglichkeiten für Angehörige. Ein<br />
längerer Aufenthalt in diesen Heimen konnte bis hin zu Hospitalismus<br />
weichenstellende Folgen für das ganze Leben haben.<br />
Die kommunalen Kinderheime, von Hohewurth in Bremerhaven<br />
abgesehen, sowie die wenigen Kleinheime in jenen Jahrzehnten<br />
waren zumindest konzeptionell kind- und familienzentriert.<br />
120 Direkte Schikanen wie Essenszwang, Schläge oder<br />
isolierte Strafunterbringung wurden aus diesen praktisch nicht<br />
berichtet. Das Problem lag im schlecht ausgebildeten, schlecht<br />
bezahlten und deshalb ständig wechselnden Personal. Leidenserfahrungen,<br />
zum Teil auch mit Langzeitfolgen für die Beziehungsfähigkeit,<br />
hingen mit diesem häufigen Verlust geliebter<br />
Bezugspersonen zusammen. Diese Verlusterfahrung konnte<br />
auch eintreten, wenn Kinder oder Jugendliche in eine Pflegefamilie<br />
verlegt wurden oder nach der Schulentlassung beziehungsweise<br />
aus disziplinarischen Gründen in ein anderes Heim<br />
mussten.<br />
Die alten Waisenhäuser innerhalb und außerhalb von Bremen<br />
(eine Sonderrolle nimmt das frühzeitig unter eine ›moderne‹<br />
Leitung gestellte St. Petri Waisenhaus ein) sowie das Kinderheim<br />
Hohewurth in Bremerhaven waren zum größten Teil bis<br />
etwa Mitte der 1960er Jahre konservative und religiös geprägte,<br />
auf Ordnung, Gehorsam und Anpassung gerichtete Erziehungsstätten.<br />
Aus ihnen stammen die Berichte über Essenszwang,<br />
das Einflößen von Erbrochenem, Eckestehen als Strafe, sinnloses<br />
Abschreiben von Texten als Strafaufgabe, beschämende<br />
Bloßstellungen und Praktiken gegenüber Bettnässerinnen und<br />
Bettnässern, Demütigungen und peinliche Verhöre nach sexuellen<br />
»Spielereien« und Selbstbefriedigung. Hinzu kamen<br />
zwanghafte Tischgebete, religiöse Belehrungen und verpflichtender<br />
Kirchgang, was die meisten Gesprächspartnerinnen und<br />
Gesprächspartner zeitlebens eher von der Kirche entfremdete.<br />
Dazu gehörten auch Strafgerichte durch die Hausväter oder<br />
eine leitende Ordensschwester, die die Strafe zum Teil noch mit<br />
Stockschlägen vollzogen. Im ersten Nachkriegsjahrzehnt mussten<br />
die Kinder und Jugendlichen zum Teil exzessiv im Garten<br />
oder im Haushalt der Heime arbeiten oder wurden an umliegende<br />
Bauernhöfe vermietet. Andere Probleme dieser Häuser<br />
waren, zumindest in den 1950er und den frühen 1960er Jahren,<br />
die Abschottung der Kinder und Jugendlichen von der Umwelt,<br />
die Erziehung durch oft schlecht ausgebildetes Personal und<br />
die Unterbringung in großen Schlafräumen ohne jedwede<br />
Rückzugsmöglichkeiten. Die Ehemaligen schilderten diese<br />
Heime häufig als Stätten einer freudlosen Kindheit und Jugend.<br />
Die Einrichtungen näherten sich strukturell erst gegen Ende der<br />
1960er Jahre den Verhältnissen in den kommunalen Kinderheimen<br />
an.<br />
In den Lehrlingswohnheimen ging es nach den Schilderungen<br />
der Gesprächspersonen zumeist rau und ruppig zu. Personal<br />
und Jugendliche standen sich in der Regel jedoch nicht<br />
feindlich gegenüber, sie begegneten einander eher in kühler<br />
Neutralität. Weit prägender als das Verhältnis zu den meist nur<br />
wenigen Erziehern war für die Lehrlinge das Verhältnis zu den<br />
Kameraden. Streiche machen, manchmal auch Saufgelage<br />
63