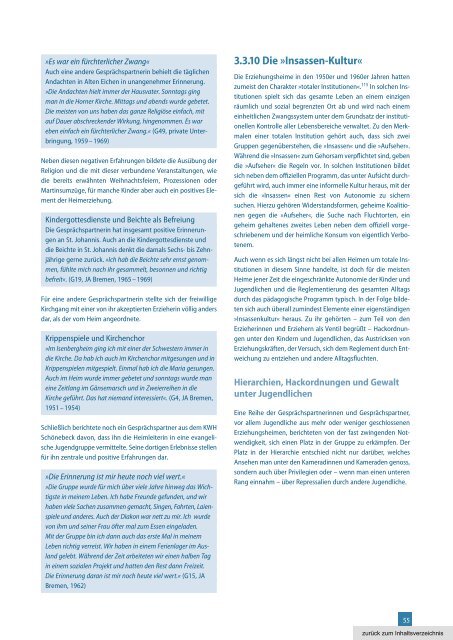1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
»Es war ein fürchterlicher Zwang«<br />
Auch eine andere Gesprächspartnerin behielt die täglichen<br />
Andachten in Alten Eichen in unangenehmer Erinnerung.<br />
»Die Andachten hielt immer der Hausvater. Sonntags ging<br />
man in die Horner Kirche. Mittags und abends wurde gebetet.<br />
Die meisten von uns haben das ganze Religiöse einfach, mit<br />
auf Dauer abschreckender Wirkung, hingenommen. Es war<br />
eben einfach ein fürchterlicher Zwang.« (G49, private Unterbringung,<br />
1959 – 1969)<br />
Neben diesen negativen Erfahrungen bildete die Ausübung der<br />
Religion und die mit dieser verbundene Veranstaltungen, wie<br />
die bereits erwähnten Weihnachtsfeiern, Prozessionen oder<br />
Martinsumzüge, für manche Kinder aber auch ein positives Element<br />
der Heimerziehung.<br />
Kindergottesdienste und Beichte als Befreiung<br />
Die Gesprächspartnerin hat insgesamt positive Erinnerungen<br />
an St. Johannis. Auch an die Kindergottesdienste und<br />
die Beichte in St. Johannis denkt die damals Sechs- bis Zehnjährige<br />
gerne zurück. »Ich hab die Beichte sehr ernst genommen,<br />
fühlte mich nach ihr gesammelt, besonnen und richtig<br />
befreit«. (G19, JA Bremen, 1965 – 1969)<br />
Für eine andere Gesprächspartnerin stellte sich der freiwillige<br />
Kirchgang mit einer von ihr akzeptierten Erzieherin völlig anders<br />
dar, als der vom Heim angeordnete.<br />
Krippenspiele und Kirchenchor<br />
»Im Isenbergheim ging ich mit einer der Schwestern immer in<br />
die Kirche. Da hab ich auch im Kirchenchor mitgesungen und in<br />
Krippenspielen mitgespielt. Einmal hab ich die Maria gesungen.<br />
Auch im Heim wurde immer gebetet und sonntags wurde man<br />
eine Zeitlang im Gänsemarsch und in Zweierreihen in die<br />
Kirche geführt. Das hat niemand interessiert«. (G4, JA Bremen,<br />
1951 – 1954)<br />
Schließlich berichtete noch ein Gesprächspartner aus dem KWH<br />
Schönebeck davon, dass ihn die Heimleiterin in eine evangelische<br />
Jugendgruppe vermittelte. Seine dortigen Erlebnisse stellen<br />
für ihn zentrale und positive Erfahrungen dar.<br />
»Die Erinnerung ist mir heute noch viel wert.«<br />
»Die Gruppe wurde für mich über viele Jahre hinweg das Wichtigste<br />
in meinem Leben. Ich habe Freunde gefunden, und wir<br />
haben viele Sachen zusammen gemacht, Singen, Fahrten, Laienspiele<br />
und anderes. Auch der Diakon war nett zu mir. Ich wurde<br />
von ihm und seiner Frau öfter mal zum Essen eingeladen.<br />
Mit der Gruppe bin ich dann auch das erste Mal in meinem<br />
Leben richtig verreist. Wir haben in einem Ferienlager im Ausland<br />
gelebt. Während der Zeit arbeiteten wir einen halben Tag<br />
in einem sozialen Projekt und hatten den Rest dann Freizeit.<br />
Die Erinnerung daran ist mir noch heute viel wert.« (G15, JA<br />
Bremen, 1962)<br />
3.3.10 Die »Insassen-Kultur«<br />
Die Erziehungsheime in den 1950er und 1960er Jahren hatten<br />
zumeist den Charakter »totaler Institutionen«. 115 In solchen Institutionen<br />
spielt sich das gesamte Leben an einem einzigen<br />
räumlich und sozial begrenzten Ort ab und wird nach einem<br />
einheitlichen Zwangssystem unter dem Grundsatz der institutionellen<br />
Kontrolle aller Lebensbereiche verwaltet. Zu den Merkmalen<br />
einer totalen Institution gehört auch, dass sich zwei<br />
Gruppen gegenüberstehen, die »Insassen« und die »Aufseher«.<br />
Während die »Insassen« zum Gehorsam verpflichtet sind, geben<br />
die »Aufseher« die Regeln vor. In solchen Institutionen bildet<br />
sich neben dem offiziellen Programm, das unter Aufsicht durchgeführt<br />
wird, auch immer eine informelle Kultur heraus, mit der<br />
sich die »Insassen« einen Rest von Autonomie zu sichern<br />
suchen. Hierzu gehören Widerstandsformen, geheime Koalitionen<br />
gegen die »Aufseher«, die Suche nach Fluchtorten, ein<br />
geheim gehaltenes zweites Leben neben dem offiziell vorgeschriebenem<br />
und der heimliche Konsum von eigentlich Verbotenem.<br />
Auch wenn es sich längst nicht bei allen Heimen um totale Institutionen<br />
in diesem Sinne handelte, ist doch für die meisten<br />
Heime jener Zeit die eingeschränkte Autonomie der Kinder und<br />
Jugendlichen und die Reglementierung des gesamten Alltags<br />
durch das pädagogische Programm typisch. In der Folge bildeten<br />
sich auch überall zumindest Elemente einer eigenständigen<br />
»Insassenkultur« heraus. Zu ihr gehörten – zum Teil von den<br />
Erzieherinnen und Erziehern als Ventil begrüßt – Hackordnungen<br />
unter den Kindern und Jugendlichen, das Austricksen von<br />
Erziehungskräften, der Versuch, sich dem Reglement durch Entweichung<br />
zu entziehen und andere Alltagsfluchten.<br />
Hierarchien, Hackordnungen und Gewalt<br />
unter Jugendlichen<br />
Eine Reihe der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner,<br />
vor allem Jugendliche aus mehr oder weniger geschlossenen<br />
Erziehungsheimen, berichteten von der fast zwingenden Notwendigkeit,<br />
sich einen Platz in der Gruppe zu erkämpfen. Der<br />
Platz in der Hierarchie entschied nicht nur darüber, welches<br />
Ansehen man unter den Kameradinnen und Kameraden genoss,<br />
sondern auch über Privilegien oder – wenn man einen unteren<br />
Rang einnahm – über Repressalien durch andere Jugendliche.<br />
55