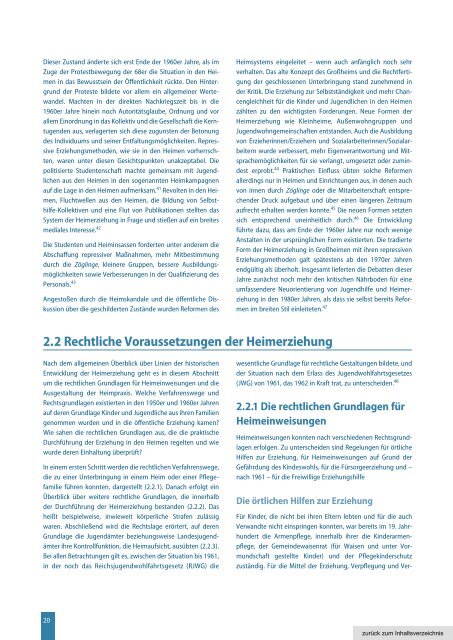1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dieser Zustand änderte sich erst Ende der 1960er Jahre, als im<br />
Zuge der Protestbewegung der 68er die Situation in den Heimen<br />
in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rückte. Den Hintergrund<br />
der Proteste bildete vor allem ein allgemeiner Wertewandel.<br />
Machten in der direkten Nachkriegszeit bis in die<br />
1960er Jahre hinein noch Autoritätsglaube, Ordnung und vor<br />
allem Einordnung in das Kollektiv und die Gesellschaft die Kerntugenden<br />
aus, verlagerten sich diese zugunsten der Betonung<br />
des Individuums und seiner Entfaltungsmöglichkeiten. Repressive<br />
Erziehungsmethoden, wie sie in den Heimen vorherrschten,<br />
waren unter diesen Gesichtspunkten unakzeptabel. Die<br />
politisierte Studentenschaft machte gemeinsam mit Jugendlichen<br />
aus den Heimen in den sogenannten Heimkampagnen<br />
auf die Lage in den Heimen aufmerksam. 41 Revolten in den Heimen,<br />
Fluchtwellen aus den Heimen, die Bildung von Selbsthilfe-Kollektiven<br />
und eine Flut von Publikationen stellten das<br />
System der Heimerziehung in Frage und stießen auf ein breites<br />
mediales Interesse. 42<br />
Die Studenten und Heiminsassen forderten unter anderem die<br />
Abschaffung repressiver Maßnahmen, mehr Mitbestimmung<br />
durch die Zöglinge, kleinere Gruppen, bessere Ausbildungsmöglichkeiten<br />
sowie Verbesserungen in der Qualifizierung des<br />
Personals. 43<br />
Angestoßen durch die Heimskandale und die öffentliche Diskussion<br />
über die geschilderten Zustände wurden Reformen des<br />
Heimsystems eingeleitet – wenn auch anfänglich noch sehr<br />
verhalten. Das alte Konzept des Großheims und die Rechtfertigung<br />
der geschlossenen Unterbringung stand zunehmend in<br />
der Kritik. Die Erziehung zur Selbstständigkeit und mehr Chancengleichheit<br />
für die Kinder und Jugendlichen in den Heimen<br />
zählten zu den wichtigsten Forderungen. Neue Formen der<br />
Heimerziehung wie Kleinheime, Außenwohngruppen und<br />
Jugendwohngemeinschaften entstanden. Auch die Ausbildung<br />
von Erzieherinnen/Erziehern und Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern<br />
wurde verbessert, mehr Eigenverantwortung und Mitsprachemöglichkeiten<br />
für sie verlangt, umgesetzt oder zumindest<br />
erprobt. 44 Praktischen Einfluss übten solche Reformen<br />
allerdings nur in Heimen und Einrichtungen aus, in denen auch<br />
von innen durch Zöglinge oder die Mitarbeiterschaft entsprechender<br />
Druck aufgebaut und über einen längeren Zeitraum<br />
aufrecht erhalten werden konnte. 45 Die neuen Formen setzten<br />
sich entsprechend uneinheitlich durch. 46 Die Entwicklung<br />
führte dazu, dass am Ende der 1960er Jahre nur noch wenige<br />
Anstalten in der ursprünglichen Form existierten. Die tradierte<br />
Form der Heimerziehung in Großheimen mit ihren repressiven<br />
Erziehungsmethoden galt spätestens ab den 1970er Jahren<br />
endgültig als überholt. Insgesamt lieferten die Debatten dieser<br />
Jahre zunächst noch mehr den kritischen Nährboden für eine<br />
umfassendere Neuorientierung von Jugendhilfe und Heimerziehung<br />
in den 1980er Jahren, als dass sie selbst bereits Reformen<br />
im breiten Stil einleiteten. 47<br />
2.2 Rechtliche Voraussetzungen der Heimerziehung<br />
Nach dem allgemeinen Überblick über Linien der historischen<br />
Entwicklung der Heimerziehung geht es in diesem Abschnitt<br />
um die rechtlichen Grundlagen für Heimeinweisungen und die<br />
Ausgestaltung der Heimpraxis. Welche Verfahrenswege und<br />
Rechtsgrundlagen existierten in den 1950er und 1960er Jahren<br />
auf deren Grundlage Kinder und Jugendliche aus ihren Familien<br />
genommen wurden und in die öffentliche Erziehung kamen<br />
Wie sahen die rechtlichen Grundlagen aus, die die praktische<br />
Durchführung der Erziehung in den Heimen regelten und wie<br />
wurde deren Einhaltung überprüft<br />
In einem ersten Schritt werden die rechtlichen Verfahrenswege,<br />
die zu einer Unterbringung in einem Heim oder einer Pflegefamilie<br />
führen konnten, dargestellt (2.2.1). Danach erfolgt ein<br />
Überblick über weitere rechtliche Grundlagen, die innerhalb<br />
der Durchführung der Heimerziehung bestanden (2.2.2). Das<br />
heißt beispielweise, inwieweit körperliche Strafen zulässig<br />
waren. Abschließend wird die Rechtslage erörtert, auf deren<br />
Grundlage die Jugendämter beziehungsweise Landesjugendämter<br />
ihre Kontrollfunktion, die Heimaufsicht, ausübten (2.2.3).<br />
Bei allen Betrachtungen gilt es, zwischen der Situation bis 1961,<br />
in der noch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) die<br />
wesentliche Grundlage für rechtliche Gestaltungen bildete, und<br />
der Situation nach dem Erlass des Jugendwohlfahrtsgesetzes<br />
(JWG) von 1961, das 1962 in Kraft trat, zu unterscheiden. 48<br />
2.2.1 Die rechtlichen Grundlagen für<br />
Heimeinweisungen<br />
Heimeinweisungen konnten nach verschiedenen Rechtsgrundlagen<br />
erfolgen. Zu unterscheiden sind Regelungen für örtliche<br />
Hilfen zur Erziehung, für Heimeinweisungen auf Grund der<br />
Gefährdung des Kindeswohls, für die Fürsorgeerziehung und –<br />
nach 1961 – für die Freiwillige Erziehungshilfe<br />
Die örtlichen Hilfen zur Erziehung<br />
Für Kinder, die nicht bei ihren Eltern lebten und für die auch<br />
Verwandte nicht einspringen konnten, war bereits im 19. Jahrhundert<br />
die Armenpflege, innerhalb ihrer die Kinderarmenpflege,<br />
der Gemeindewaisenrat (für Waisen und unter Vormundschaft<br />
gestellte Kinder) und der Pflegekinderschutz<br />
zuständig. Für die Mittel der Erziehung, Verpflegung und Ver-<br />
20