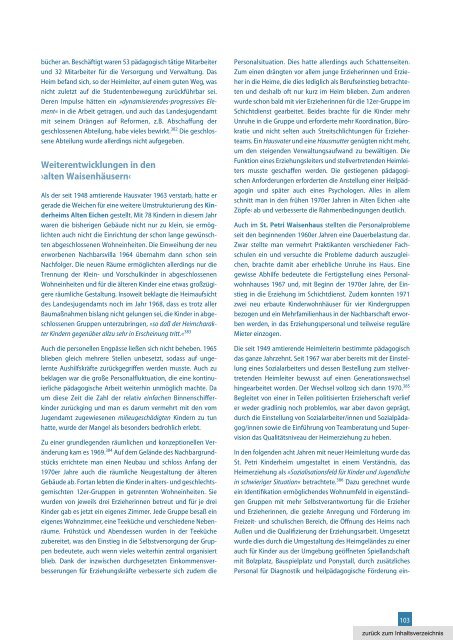1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ücher an. Beschäftigt waren 53 pädagogisch tätige Mitarbeiter<br />
und 32 Mitarbeiter für die Versorgung und Verwaltung. Das<br />
Heim befand sich, so der Heimleiter, auf einem guten Weg, was<br />
nicht zuletzt auf die Studentenbewegung zurückführbar sei.<br />
Deren Impulse hätten ein »dynamisierendes-progressives Element«<br />
in die Arbeit getragen, und auch das Landesjugendamt<br />
mit seinem Drängen auf Reformen, z.B. Abschaffung der<br />
geschlossenen Abteilung, habe vieles bewirkt. 382 Die geschlossene<br />
Abteilung wurde allerdings nicht aufgegeben.<br />
Weiterentwicklungen in den<br />
›alten Waisenhäusern‹<br />
Als der seit 1948 amtierende Hausvater 1963 verstarb, hatte er<br />
gerade die Weichen für eine weitere Umstrukturierung des Kinderheims<br />
Alten Eichen gestellt. Mit 78 Kindern in diesem Jahr<br />
waren die bisherigen Gebäude nicht nur zu klein, sie ermöglichten<br />
auch nicht die Einrichtung der schon lange gewünschten<br />
abgeschlossenen Wohneinheiten. Die Einweihung der neu<br />
erworbenen Nachbarsvilla 1964 übernahm dann schon sein<br />
Nachfolger. Die neuen Räume ermöglichten allerdings nur die<br />
Trennung der Klein- und Vorschulkinder in abgeschlossenen<br />
Wohneinheiten und für die älteren Kinder eine etwas großzügigere<br />
räumliche Gestaltung. Insoweit beklagte die Heimaufsicht<br />
des Landesjugendamts noch im Jahr 1968, dass es trotz aller<br />
Baumaßnahmen bislang nicht gelungen sei, die Kinder in abgeschlossenen<br />
Gruppen unterzubringen, »so daß der Heimcharakter<br />
Kindern gegenüber allzu sehr in Erscheinung tritt.« 383<br />
Auch die personellen Engpässe ließen sich nicht beheben. 1965<br />
blieben gleich mehrere Stellen unbesetzt, sodass auf ungelernte<br />
Aushilfskräfte zurückgegriffen werden musste. Auch zu<br />
beklagen war die große Personalfluktuation, die eine kontinuierliche<br />
pädagogische Arbeit weiterhin unmöglich machte. Da<br />
um diese Zeit die Zahl der relativ einfachen Binnenschifferkinder<br />
zurückging und man es darum vermehrt mit den vom<br />
Jugendamt zugewiesenen milieugeschädigten Kindern zu tun<br />
hatte, wurde der Mangel als besonders bedrohlich erlebt.<br />
Zu einer grundlegenden räumlichen und konzeptionellen Veränderung<br />
kam es 1969. 384 Auf dem Gelände des Nachbargrundstücks<br />
errichtete man einen Neubau und schloss Anfang der<br />
1970er Jahre auch die räumliche Neugestaltung der älteren<br />
Gebäude ab. Fortan lebten die Kinder in alters- und geschlechtsgemischten<br />
12er-Gruppen in getrennten Wohneinheiten. Sie<br />
wurden von jeweils drei Erzieherinnen betreut und für je drei<br />
Kinder gab es jetzt ein eigenes Zimmer. Jede Gruppe besaß ein<br />
eigenes Wohnzimmer, eine Teeküche und verschiedene Nebenräume.<br />
Frühstück und Abendessen wurden in der Teeküche<br />
zubereitet, was den Einstieg in die Selbstversorgung der Gruppen<br />
bedeutete, auch wenn vieles weiterhin zentral organisiert<br />
blieb. Dank der inzwischen durchgesetzten Einkommensverbesserungen<br />
für Erziehungskräfte verbesserte sich zudem die<br />
Personalsituation. Dies hatte allerdings auch Schattenseiten.<br />
Zum einen drängten vor allem junge Erzieherinnen und Erzieher<br />
in die Heime, die dies lediglich als Berufseinstieg betrachteten<br />
und deshalb oft nur kurz im Heim blieben. Zum anderen<br />
wurde schon bald mit vier Erzieherinnen für die 12er-Gruppe im<br />
Schichtdienst gearbeitet. Beides brachte für die Kinder mehr<br />
Unruhe in die Gruppe und erforderte mehr Koordination, Bürokratie<br />
und nicht selten auch Streitschlichtungen für Erzieherteams.<br />
Ein Hausvater und eine Hausmutter genügten nicht mehr,<br />
um den steigenden Verwaltungsaufwand zu bewältigen. Die<br />
Funktion eines Erziehungsleiters und stellvertretenden Heimleiters<br />
musste geschaffen werden. Die gestiegenen pädagogischen<br />
Anforderungen erforderten die Anstellung einer Heilpädagogin<br />
und später auch eines Psychologen. Alles in allem<br />
schnitt man in den frühen 1970er Jahren in Alten Eichen ›alte<br />
Zöpfe‹ ab und verbesserte die Rahmenbedingungen deutlich.<br />
Auch im St. Petri Waisenhaus stellten die Personalprobleme<br />
seit den beginnenden 1960er Jahren eine Dauerbelastung dar.<br />
Zwar stellte man vermehrt Praktikanten verschiedener Fachschulen<br />
ein und versuchte die Probleme dadurch auszugleichen,<br />
brachte damit aber erhebliche Unruhe ins Haus. Eine<br />
gewisse Abhilfe bedeutete die Fertigstellung eines Personalwohnhauses<br />
1967 und, mit Beginn der 1970er Jahre, der Einstieg<br />
in die Erziehung im Schichtdienst. Zudem konnten 1971<br />
zwei neu erbaute Kinderwohnhäuser für vier Kindergruppen<br />
bezogen und ein Mehrfamilienhaus in der Nachbarschaft erworben<br />
werden, in das Erziehungspersonal und teilweise reguläre<br />
Mieter einzogen.<br />
Die seit 1949 amtierende Heimleiterin bestimmte pädagogisch<br />
das ganze Jahrzehnt. Seit 1967 war aber bereits mit der Einstellung<br />
eines Sozialarbeiters und dessen Bestellung zum stellvertretenden<br />
Heimleiter bewusst auf einen Generationswechsel<br />
hingearbeitet worden. Der Wechsel vollzog sich dann 1970. 385<br />
Begleitet von einer in Teilen politisierten Erzieherschaft verlief<br />
er weder gradlinig noch problemlos, war aber davon geprägt,<br />
durch die Einstellung von Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagog/innen<br />
sowie die Einführung von Teamberatung und Supervision<br />
das Qualitätsniveau der Heimerziehung zu heben.<br />
In den folgenden acht Jahren mit neuer Heimleitung wurde das<br />
St. Petri Kinderheim umgestaltet in einem Verständnis, das<br />
Heimerziehung als »Sozialisationsfeld für Kinder und Jugendliche<br />
in schwieriger Situation« betrachtete. 386 Dazu gerechnet wurde<br />
ein Identifikation ermöglichendes Wohnumfeld in eigenständigen<br />
Gruppen mit mehr Selbstverantwortung für die Erzieher<br />
und Erzieherinnen, die gezielte Anregung und Förderung im<br />
Freizeit- und schulischen Bereich, die Öffnung des Heims nach<br />
Außen und die Qualifizierung der Erziehungsarbeit. Umgesetzt<br />
wurde dies durch die Umgestaltung des Heimgeländes zu einer<br />
auch für Kinder aus der Umgebung geöffneten Spiellandschaft<br />
mit Bolzplatz, Bauspielplatz und Ponystall, durch zusätzliches<br />
Personal für Diagnostik und heilpädagogische Förderung ein-<br />
103