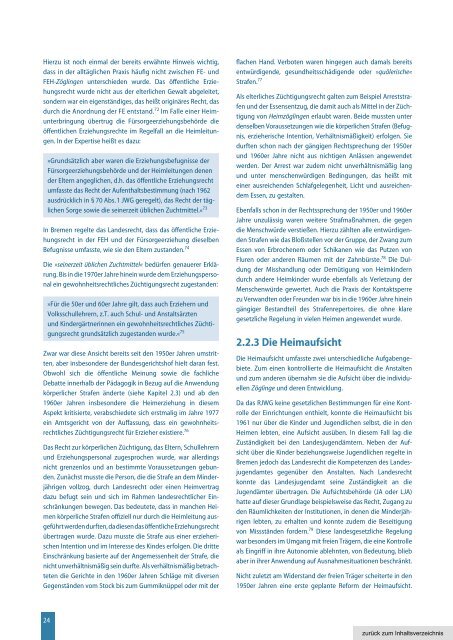1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hierzu ist noch einmal der bereits erwähnte Hinweis wichtig,<br />
dass in der alltäglichen Praxis häufig nicht zwischen FE- und<br />
FEH-Zöglingen unterschieden wurde. Das öffentliche Erziehungsrecht<br />
wurde nicht aus der elterlichen Gewalt abgeleitet,<br />
sondern war ein eigenständiges, das heißt originäres Recht, das<br />
durch die Anordnung der FE entstand. 72 Im Falle einer Heimunterbringung<br />
übertrug die Fürsorgeerziehungsbehörde die<br />
öffentlichen Erziehungsrechte im Regelfall an die Heimleitungen.<br />
In der Expertise heißt es dazu:<br />
»Grundsätzlich aber waren die Erziehungsbefugnisse der<br />
Fürsorgeerziehungsbehörde und der Heimleitungen denen<br />
der Eltern angeglichen, d.h. das öffentliche Erziehungsrecht<br />
umfasste das Recht der Aufenthaltsbestimmung (nach 1962<br />
ausdrücklich in § 70 Abs. 1 JWG geregelt), das Recht der täglichen<br />
Sorge sowie die seinerzeit üblichen Zuchtmittel.« 73<br />
In Bremen regelte das Landesrecht, dass das öffentliche Erziehungsrecht<br />
in der FEH und der Fürsorgeerziehung dieselben<br />
Befugnisse umfasste, wie sie den Eltern zustanden. 74<br />
Die »seinerzeit üblichen Zuchtmittel« bedürfen genauerer Erklärung.<br />
Bis in die 1970er Jahre hinein wurde dem Erziehungspersonal<br />
ein gewohnheitsrechtliches Züchtigungsrecht zugestanden:<br />
»Für die 50er und 60er Jahre gilt, dass auch Erziehern und<br />
Volksschullehrern, z.T. auch Schul- und Anstaltsärzten<br />
und Kindergärtnerinnen ein gewohnheitsrechtliches Züchtigungsrecht<br />
grundsätzlich zugestanden wurde.« 75<br />
Zwar war diese Ansicht bereits seit den 1950er Jahren umstritten,<br />
aber insbesondere der Bundesgerichtshof hielt daran fest.<br />
Obwohl sich die öffentliche Meinung sowie die fachliche<br />
Debatte innerhalb der Pädagogik in Bezug auf die Anwendung<br />
körperlicher Strafen änderte (siehe Kapitel 2.3) und ab den<br />
1960er Jahren insbesondere die Heimerziehung in diesem<br />
Aspekt kritisierte, verabschiedete sich erstmalig im Jahre 1977<br />
ein Amtsgericht von der Auffassung, dass ein gewohnheitsrechtliches<br />
Züchtigungsrecht für Erzieher existiere. 76<br />
Das Recht zur körperlichen Züchtigung, das Eltern, Schullehrern<br />
und Erziehungspersonal zugesprochen wurde, war allerdings<br />
nicht grenzenlos und an bestimmte Voraussetzungen gebunden.<br />
Zunächst musste die Person, die die Strafe an dem Minderjährigen<br />
vollzog, durch Landesrecht oder einen Heimvertrag<br />
dazu befugt sein und sich im Rahmen landesrechtlicher Einschränkungen<br />
bewegen. Das bedeutete, dass in manchen Heimen<br />
körperliche Strafen offiziell nur durch die Heimleitung ausgeführt<br />
werden durften, da diesen das öffentliche Erziehungsrecht<br />
übertragen wurde. Dazu musste die Strafe aus einer erzieherischen<br />
Intention und im Interesse des Kindes erfolgen. Die dritte<br />
Einschränkung basierte auf der Angemessenheit der Strafe, die<br />
nicht unverhältnismäßig sein durfte. Als verhältnismäßig betrachteten<br />
die Gerichte in den 1960er Jahren Schläge mit diversen<br />
Gegenständen vom Stock bis zum Gummiknüppel oder mit der<br />
flachen Hand. Verboten waren hingegen auch damals bereits<br />
entwürdigende, gesundheitsschädigende oder »quälerische«<br />
Strafen. 77<br />
Als elterliches Züchtigungsrecht galten zum Beispiel Arreststrafen<br />
und der Essensentzug, die damit auch als Mittel in der Züchtigung<br />
von Heimzöglingen erlaubt waren. Beide mussten unter<br />
denselben Voraussetzungen wie die körperlichen Strafen (Befugnis,<br />
erzieherische Intention, Verhältnismäßigkeit) erfolgen. Sie<br />
durften schon nach der gängigen Rechtsprechung der 1950er<br />
und 1960er Jahre nicht aus nichtigen Anlässen angewendet<br />
werden. Der Arrest war zudem nicht unverhältnismäßig lang<br />
und unter menschenwürdigen Bedingungen, das heißt mit<br />
einer ausreichenden Schlafgelegenheit, Licht und ausreichendem<br />
Essen, zu gestalten.<br />
Ebenfalls schon in der Rechtssprechung der 1950er und 1960er<br />
Jahre unzulässig waren weitere Strafmaßnahmen, die gegen<br />
die Menschwürde verstießen. Hierzu zählten alle entwürdigenden<br />
Strafen wie das Bloßstellen vor der Gruppe, der Zwang zum<br />
Essen von Erbrochenem oder Schikanen wie das Putzen von<br />
Fluren oder anderen Räumen mit der Zahnbürste. 78 Die Duldung<br />
der Misshandlung oder Demütigung von Heimkindern<br />
durch andere Heimkinder wurde ebenfalls als Verletzung der<br />
Menschenwürde gewertet. Auch die Praxis der Kontaktsperre<br />
zu Verwandten oder Freunden war bis in die 1960er Jahre hinein<br />
gängiger Bestandteil des Strafenrepertoires, die ohne klare<br />
gesetzliche Regelung in vielen Heimen angewendet wurde.<br />
2.2.3 Die Heimaufsicht<br />
Die Heimaufsicht umfasste zwei unterschiedliche Aufgabengebiete.<br />
Zum einen kontrollierte die Heimaufsicht die Anstalten<br />
und zum anderen übernahm sie die Aufsicht über die individuellen<br />
Zöglinge und deren Entwicklung.<br />
Da das RJWG keine gesetzlichen Bestimmungen für eine Kontrolle<br />
der Einrichtungen enthielt, konnte die Heimaufsicht bis<br />
1961 nur über die Kinder und Jugendlichen selbst, die in den<br />
Heimen lebten, eine Aufsicht ausüben. In diesem Fall lag die<br />
Zuständigkeit bei den Landesjugendämtern. Neben der Aufsicht<br />
über die Kinder beziehungsweise Jugendlichen regelte in<br />
Bremen jedoch das Landesrecht die Kompetenzen des Landesjugendamtes<br />
gegenüber den Anstalten. Nach Landesrecht<br />
konnte das Landesjugendamt seine Zuständigkeit an die<br />
Jugendämter übertragen. Die Aufsichtsbehörde (JA oder LJA)<br />
hatte auf dieser Grundlage beispielsweise das Recht, Zugang zu<br />
den Räumlichkeiten der Institutionen, in denen die Minderjährigen<br />
lebten, zu erhalten und konnte zudem die Beseitigung<br />
von Missständen fordern. 79 Diese landesgesetzliche Regelung<br />
war besonders im Umgang mit freien Trägern, die eine Kontrolle<br />
als Eingriff in ihre Autonomie ablehnten, von Bedeutung, blieb<br />
aber in ihrer Anwendung auf Ausnahmesituationen beschränkt.<br />
Nicht zuletzt am Widerstand der freien Träger scheiterte in den<br />
1950er Jahren eine erste geplante Reform der Heimaufsicht.<br />
24