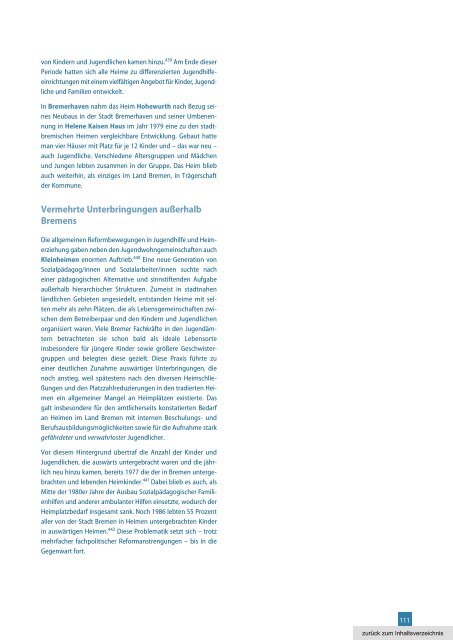1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
von Kindern und Jugendlichen kamen hinzu. 439 Am Ende dieser<br />
Periode hatten sich alle Heime zu differenzierten Jugendhilfeeinrichtungen<br />
mit einem vielfältigen Angebot für Kinder, Jugendliche<br />
und Familien entwickelt.<br />
In Bremerhaven nahm das Heim Hohewurth nach Bezug seines<br />
Neubaus in der Stadt Bremerhaven und seiner Umbenennung<br />
in Helene Kaisen Haus im Jahr 1979 eine zu den stadtbremischen<br />
Heimen vergleichbare Entwicklung. Gebaut hatte<br />
man vier Häuser mit Platz für je 12 Kinder und – das war neu –<br />
auch Jugendliche. Verschiedene Altersgruppen und Mädchen<br />
und Jungen lebten zusammen in der Gruppe. Das Heim blieb<br />
auch weiterhin, als einziges im Land Bremen, in Trägerschaft<br />
der Kommune.<br />
Vermehrte Unterbringungen außerhalb<br />
Bremens<br />
Die allgemeinen Reformbewegungen in Jugendhilfe und Heimerziehung<br />
gaben neben den Jugendwohngemeinschaften auch<br />
Kleinheimen enormen Auftrieb. 440 Eine neue Generation von<br />
Sozialpädagog/innen und Sozialarbeiter/innen suchte nach<br />
einer pädagogischen Alternative und sinnstiftenden Aufgabe<br />
außerhalb hierarchischer Strukturen. Zumeist in stadtnahen<br />
ländlichen Gebieten angesiedelt, entstanden Heime mit selten<br />
mehr als zehn Plätzen, die als Lebensgemeinschaften zwischen<br />
dem Betreiberpaar und den Kindern und Jugendlichen<br />
organisiert waren. Viele Bremer Fachkräfte in den Jugendämtern<br />
betrachteten sie schon bald als ideale Lebensorte<br />
insbesondere für jüngere Kinder sowie größere Geschwistergruppen<br />
und belegten diese gezielt. Diese Praxis führte zu<br />
einer deutlichen Zunahme auswärtiger Unterbringungen, die<br />
noch anstieg, weil spätestens nach den diversen Heimschließungen<br />
und den Platzzahlreduzierungen in den tradierten Heimen<br />
ein allgemeiner Mangel an Heimplätzen existierte. Das<br />
galt insbesondere für den amtlicherseits konstatierten Bedarf<br />
an Heimen im Land Bremen mit internen Beschulungs- und<br />
Berufsausbildungsmöglichkeiten sowie für die Aufnahme stark<br />
gefährdeter und verwahrloster Jugendlicher.<br />
Vor diesem Hintergrund übertraf die Anzahl der Kinder und<br />
Jugendlichen, die auswärts untergebracht waren und die jährlich<br />
neu hinzu kamen, bereits 1977 die der in Bremen untergebrachten<br />
und lebenden Heimkinder. 441 Dabei blieb es auch, als<br />
Mitte der 1980er Jahre der Ausbau Sozialpädagogischer Familienhilfen<br />
und anderer ambulanter Hilfen einsetzte, wodurch der<br />
Heimplatzbedarf insgesamt sank. Noch 1986 lebten 55 Prozent<br />
aller von der Stadt Bremen in Heimen untergebrachten Kinder<br />
in auswärtigen Heimen. 442 Diese Problematik setzt sich – trotz<br />
mehrfacher fachpolitischer Reformanstrengungen – bis in die<br />
Gegenwart fort.<br />
111