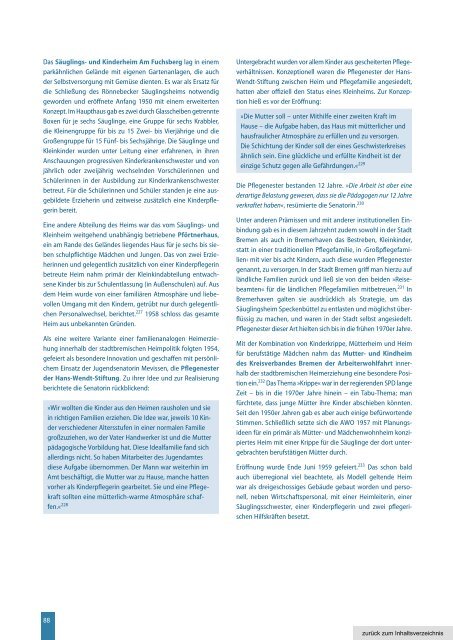1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Säuglings- und Kinderheim Am Fuchsberg lag in einem<br />
parkähnlichen Gelände mit eigenen Gartenanlagen, die auch<br />
der Selbstversorgung mit Gemüse dienten. Es war als Ersatz für<br />
die Schließung des Rönnebecker Säuglingsheims notwendig<br />
geworden und eröffnete Anfang 1950 mit einem erweiterten<br />
Konzept. Im Haupthaus gab es zwei durch Glasscheiben getrennte<br />
Boxen für je sechs Säuglinge, eine Gruppe für sechs Krabbler,<br />
die Kleinengruppe für bis zu 15 Zwei- bis Vierjährige und die<br />
Großengruppe für 15 Fünf- bis Sechsjährige. Die Säuglinge und<br />
Kleinkinder wurden unter Leitung einer erfahrenen, in ihren<br />
Anschauungen progressiven Kinderkrankenschwester und von<br />
jährlich oder zweijährig wechselnden Vorschülerinnen und<br />
Schülerinnen in der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester<br />
betreut. Für die Schülerinnen und Schüler standen je eine ausgebildete<br />
Erzieherin und zeitweise zusätzlich eine Kinderpflegerin<br />
bereit.<br />
Eine andere Abteilung des Heims war das vom Säuglings- und<br />
Kleinheim weitgehend unabhängig betriebene Pförtnerhaus,<br />
ein am Rande des Geländes liegendes Haus für je sechs bis sieben<br />
schulpflichtige Mädchen und Jungen. Das von zwei Erzieherinnen<br />
und gelegentlich zusätzlich von einer Kinderpflegerin<br />
betreute Heim nahm primär der Kleinkindabteilung entwachsene<br />
Kinder bis zur Schulentlassung (in Außenschulen) auf. Aus<br />
dem Heim wurde von einer familiären Atmosphäre und liebevollen<br />
Umgang mit den Kindern, getrübt nur durch gelegentlichen<br />
Personalwechsel, berichtet. 227 1958 schloss das gesamte<br />
Heim aus unbekannten Gründen.<br />
Als eine weitere Variante einer familienanalogen Heimerziehung<br />
innerhalb der stadtbremischen Heimpolitik folgten 1954,<br />
gefeiert als besondere Innovation und geschaffen mit persönlichem<br />
Einsatz der Jugendsenatorin Mevissen, die Pflegenester<br />
der Hans-Wendt-Stiftung. Zu ihrer Idee und zur Realisierung<br />
berichtete die Senatorin rückblickend:<br />
»Wir wollten die Kinder aus den Heimen rausholen und sie<br />
in richtigen Familien erziehen. Die Idee war, jeweils 10 Kinder<br />
verschiedener Altersstufen in einer normalen Familie<br />
großzuziehen, wo der Vater Handwerker ist und die Mutter<br />
pädagogische Vorbildung hat. Diese Idealfamilie fand sich<br />
allerdings nicht. So haben Mitarbeiter des Jugendamtes<br />
diese Aufgabe übernommen. Der Mann war weiterhin im<br />
Amt beschäftigt, die Mutter war zu Hause, manche hatten<br />
vorher als Kinderpflegerin gearbeitet. Sie und eine Pflegekraft<br />
sollten eine mütterlich-warme Atmosphäre schaffen.«<br />
228<br />
Untergebracht wurden vor allem Kinder aus gescheiterten Pflegeverhältnissen.<br />
Konzeptionell waren die Pflegenester der Hans-<br />
Wendt-Stiftung zwischen Heim und Pflegefamilie angesiedelt,<br />
hatten aber offiziell den Status eines Kleinheims. Zur Konzeption<br />
hieß es vor der Eröffnung:<br />
»Die Mutter soll – unter Mithilfe einer zweiten Kraft im<br />
Hause – die Aufgabe haben, das Haus mit mütterlicher und<br />
hausfraulicher Atmosphäre zu erfüllen und zu versorgen.<br />
Die Schichtung der Kinder soll der eines Geschwisterkreises<br />
ähnlich sein. Eine glückliche und erfüllte Kindheit ist der<br />
einzige Schutz gegen alle Gefährdungen.« 229<br />
Die Pflegenester bestanden 12 Jahre. »Die Arbeit ist aber eine<br />
derartige Belastung gewesen, dass sie die Pädagogen nur 12 Jahre<br />
verkraftet haben«, resümierte die Senatorin. 230<br />
Unter anderen Prämissen und mit anderer institutionellen Einbindung<br />
gab es in diesem Jahrzehnt zudem sowohl in der Stadt<br />
Bremen als auch in Bremerhaven das Bestreben, Kleinkinder,<br />
statt in einer traditionellen Pflegefamilie, in ›Großpflegefamilien‹<br />
mit vier bis acht Kindern, auch diese wurden Pflegenester<br />
genannt, zu versorgen. In der Stadt Bremen griff man hierzu auf<br />
ländliche Familien zurück und ließ sie von den beiden »Reisebeamten«<br />
für die ländlichen Pflegefamilien mitbetreuen. 231 In<br />
Bremerhaven galten sie ausdrücklich als Strategie, um das<br />
Säuglingsheim Speckenbüttel zu entlasten und möglichst überflüssig<br />
zu machen, und waren in der Stadt selbst angesiedelt.<br />
Pflegenester dieser Art hielten sich bis in die frühen 1970er Jahre.<br />
Mit der Kombination von Kinderkrippe, Mütterheim und Heim<br />
für berufstätige Mädchen nahm das Mutter- und Kindheim<br />
des Kreisverbandes Bremen der Arbeiterwohlfahrt innerhalb<br />
der stadtbremischen Heimerziehung eine besondere Position<br />
ein. 232 Das Thema »Krippe« war in der regierenden SPD lange<br />
Zeit – bis in die 1970er Jahre hinein – ein Tabu-Thema; man<br />
fürchtete, dass junge Mütter ihre Kinder abschieben könnten.<br />
Seit den 1950er Jahren gab es aber auch einige befürwortende<br />
Stimmen. Schließlich setzte sich die AWO 1957 mit Planungsideen<br />
für ein primär als Mütter- und Mädchenwohnheim konzipiertes<br />
Heim mit einer Krippe für die Säuglinge der dort untergebrachten<br />
berufstätigen Mütter durch.<br />
Eröffnung wurde Ende Juni 1959 gefeiert. 233 Das schon bald<br />
auch überregional viel beachtete, als Modell geltende Heim<br />
war als dreigeschossiges Gebäude gebaut worden und personell,<br />
neben Wirtschaftspersonal, mit einer Heimleiterin, einer<br />
Säuglingsschwester, einer Kinderpflegerin und zwei pflegerischen<br />
Hilfskräften besetzt.<br />
88