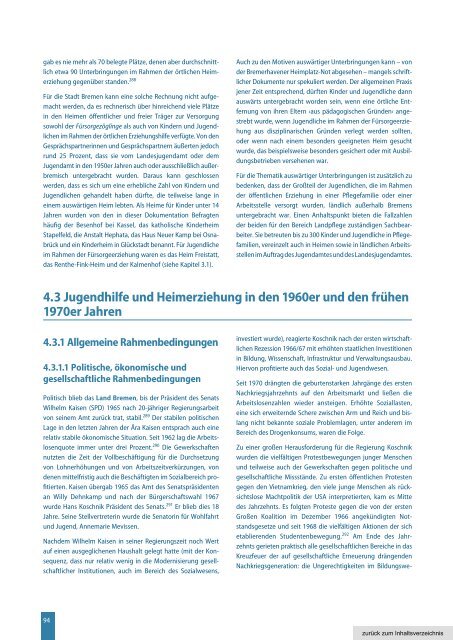1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gab es nie mehr als 70 belegte Plätze, denen aber durchschnittlich<br />
etwa 90 Unterbringungen im Rahmen der örtlichen Heimerziehung<br />
gegenüber standen. 288<br />
Für die Stadt Bremen kann eine solche Rechnung nicht aufgemacht<br />
werden, da es rechnerisch über hinreichend viele Plätze<br />
in den Heimen öffentlicher und freier Träger zur Versorgung<br />
sowohl der Fürsorgezöglinge als auch von Kindern und Jugendlichen<br />
im Rahmen der örtlichen Erziehungshilfe verfügte. Von den<br />
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern äußerten jedoch<br />
rund 25 Prozent, dass sie vom Landesjugendamt oder dem<br />
Jugendamt in den 1950er Jahren auch oder ausschließlich außerbremisch<br />
untergebracht wurden. Daraus kann geschlossen<br />
werden, dass es sich um eine erhebliche Zahl von Kindern und<br />
Jugendlichen gehandelt haben dürfte, die teilweise lange in<br />
einem auswärtigen Heim lebten. Als Heime für Kinder unter 14<br />
Jahren wurden von den in dieser Dokumentation Befragten<br />
häufig der Besenhof bei Kassel, das katholische Kinderheim<br />
Stapelfeld, die Anstalt Hephata, das Haus Neuer Kamp bei Osnabrück<br />
und ein Kinderheim in Glückstadt benannt. Für Jugendliche<br />
im Rahmen der Fürsorgeerziehung waren es das Heim Freistatt,<br />
das Renthe-Fink-Heim und der Kalmenhof (siehe Kapitel 3.1).<br />
Auch zu den Motiven auswärtiger Unterbringungen kann – von<br />
der Bremerhavener Heimplatz-Not abgesehen – mangels schriftlicher<br />
Dokumente nur spekuliert werden. Der allgemeinen Praxis<br />
jener Zeit entsprechend, dürften Kinder und Jugendliche dann<br />
auswärts untergebracht worden sein, wenn eine örtliche Entfernung<br />
von ihren Eltern ›aus pädagogischen Gründen‹ angestrebt<br />
wurde, wenn Jugendliche im Rahmen der Fürsorgeerziehung<br />
aus disziplinarischen Gründen verlegt werden sollten,<br />
oder wenn nach einem besonders geeigneten Heim gesucht<br />
wurde, das beispielsweise besonders gesichert oder mit Ausbildungsbetrieben<br />
versehenen war.<br />
Für die Thematik auswärtiger Unterbringungen ist zusätzlich zu<br />
bedenken, dass der Großteil der Jugendlichen, die im Rahmen<br />
der öffentlichen Erziehung in einer Pflegefamilie oder einer<br />
Arbeitsstelle versorgt wurden, ländlich außerhalb Bremens<br />
untergebracht war. Einen Anhaltspunkt bieten die Fallzahlen<br />
der beiden für den Bereich Landpflege zuständigen Sachbearbeiter.<br />
Sie betreuten bis zu 300 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien,<br />
vereinzelt auch in Heimen sowie in ländlichen Arbeitsstellen<br />
im Auftrag des Jugendamtes und des Landes jugendamtes.<br />
4.3 Jugendhilfe und Heimerziehung in den 1960er und den frühen<br />
1970er Jahren<br />
4.3.1 Allgemeine Rahmenbedingungen<br />
4.3.1.1 Politische, ökonomische und<br />
gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
Politisch blieb das Land Bremen, bis der Präsident des Senats<br />
Wilhelm Kaisen (SPD) 1965 nach 20-jähriger Regierungsarbeit<br />
von seinem Amt zurück trat, stabil. 289 Der stabilen politischen<br />
Lage in den letzten Jahren der Ära Kaisen entsprach auch eine<br />
relativ stabile ökonomische Situation. Seit 1962 lag die Arbeitslosenquote<br />
immer unter drei Prozent. 290 Die Gewerkschaften<br />
nutzten die Zeit der Vollbeschäftigung für die Durchsetzung<br />
von Lohnerhöhungen und von Arbeitszeitverkürzungen, von<br />
denen mittelfristig auch die Beschäftigten im Sozialbereich profitierten.<br />
Kaisen übergab 1965 das Amt des Senatspräsidenten<br />
an Willy Dehnkamp und nach der Bürgerschaftswahl 1967<br />
wurde Hans Koschnik Präsident des Senats. 291 Er blieb dies 18<br />
Jahre. Seine Stellvertreterin wurde die Senatorin für Wohlfahrt<br />
und Jugend, Annemarie Mevissen.<br />
Nachdem Wilhelm Kaisen in seiner Regierungszeit noch Wert<br />
auf einen ausgeglichenen Haushalt gelegt hatte (mit der Konsequenz,<br />
dass nur relativ wenig in die Modernisierung gesellschaftlicher<br />
Institutionen, auch im Bereich des Sozialwesens,<br />
investiert wurde), reagierte Koschnik nach der ersten wirtschaftlichen<br />
Rezession 1966/67 mit erhöhten staatlichen Investitionen<br />
in Bildung, Wissenschaft, Infrastruktur und Verwaltungsausbau.<br />
Hiervon profitierte auch das Sozial- und Jugendwesen.<br />
Seit 1970 drängten die geburtenstarken Jahrgänge des ersten<br />
Nachkriegsjahrzehnts auf den Arbeitsmarkt und ließen die<br />
Arbeitslosenzahlen wieder ansteigen. Erhöhte Soziallasten,<br />
eine sich erweiternde Schere zwischen Arm und Reich und bislang<br />
nicht bekannte soziale Problemlagen, unter anderem im<br />
Bereich des Drogenkonsums, waren die Folge.<br />
Zu einer großen Herausforderung für die Regierung Koschnik<br />
wurden die vielfältigen Protestbewegungen junger Menschen<br />
und teilweise auch der Gewerkschaften gegen politische und<br />
gesellschaftliche Missstände. Zu ersten öffentlichen Protesten<br />
gegen den Vietnamkrieg, den viele junge Menschen als rücksichtslose<br />
Machtpolitik der USA interpretierten, kam es Mitte<br />
des Jahrzehnts. Es folgten Proteste gegen die von der ersten<br />
Großen Koalition im Dezember 1966 angekündigten Notstandsgesetze<br />
und seit 1968 die vielfältigen Aktionen der sich<br />
etablierenden Studentenbewegung. 292 Am Ende des Jahrzehnts<br />
gerieten praktisch alle gesellschaftlichen Bereiche in das<br />
Kreuzfeuer der auf gesellschaftliche Erneuerung drängenden<br />
Nachkriegsgeneration: die Ungerechtigkeiten im Bildungswe-<br />
94