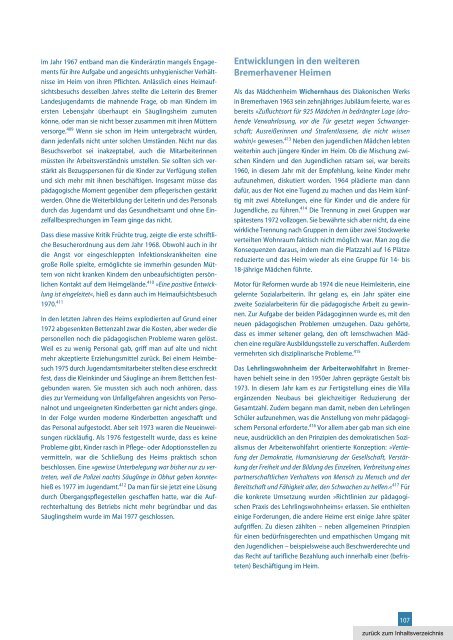1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Im Jahr 1967 entband man die Kinderärztin mangels Engagements<br />
für ihre Aufgabe und angesichts unhygienischer Verhältnisse<br />
im Heim von ihren Pflichten. Anlässlich eines Heimaufsichtsbesuchs<br />
desselben Jahres stellte die Leiterin des Bremer<br />
Landesjugendamts die mahnende Frage, ob man Kindern im<br />
ersten Lebensjahr überhaupt ein Säuglingsheim zumuten<br />
könne, oder man sie nicht besser zusammen mit ihren Müttern<br />
versorge. 409 Wenn sie schon im Heim untergebracht würden,<br />
dann jedenfalls nicht unter solchen Umständen. Nicht nur das<br />
Besuchsverbot sei inakzeptabel, auch die Mitarbeiterinnen<br />
müssten ihr Arbeitsverständnis umstellen. Sie sollten sich verstärkt<br />
als Bezugspersonen für die Kinder zur Verfügung stellen<br />
und sich mehr mit ihnen beschäftigen. Insgesamt müsse das<br />
pädagogische Moment gegenüber dem pflegerischen gestärkt<br />
werden. Ohne die Weiterbildung der Leiterin und des Personals<br />
durch das Jugendamt und das Gesundheitsamt und ohne Einzelfallbesprechungen<br />
im Team ginge das nicht.<br />
Dass diese massive Kritik Früchte trug, zeigte die erste schriftliche<br />
Besucherordnung aus dem Jahr 1968. Obwohl auch in ihr<br />
die Angst vor eingeschleppten Infektionskrankheiten eine<br />
große Rolle spielte, ermöglichte sie immerhin gesunden Müttern<br />
von nicht kranken Kindern den unbeaufsichtigten persönlichen<br />
Kontakt auf dem Heimgelände. 410 »Eine positive Entwicklung<br />
ist eingeleitet«, hieß es dann auch im Heimaufsichtsbesuch<br />
1970. 411<br />
In den letzten Jahren des Heims explodierten auf Grund einer<br />
1972 abgesenkten Bettenzahl zwar die Kosten, aber weder die<br />
personellen noch die pädagogischen Probleme waren gelöst.<br />
Weil es zu wenig Personal gab, griff man auf alte und nicht<br />
mehr akzeptierte Erziehungsmittel zurück. Bei einem Heimbesuch<br />
1975 durch Jugendamtsmitarbeiter stellten diese erschreckt<br />
fest, dass die Kleinkinder und Säuglinge an ihrem Bettchen festgebunden<br />
waren. Sie mussten sich auch noch anhören, dass<br />
dies zur Vermeidung von Unfallgefahren angesichts von Personalnot<br />
und ungeeigneten Kinderbetten gar nicht anders ginge.<br />
In der Folge wurden moderne Kinderbetten angeschafft und<br />
das Personal aufgestockt. Aber seit 1973 waren die Neueinweisungen<br />
rückläufig. Als 1976 festgestellt wurde, dass es keine<br />
Probleme gibt, Kinder rasch in Pflege- oder Adoptionsstellen zu<br />
vermitteln, war die Schließung des Heims praktisch schon<br />
beschlossen. Eine »gewisse Unterbelegung war bisher nur zu vertreten,<br />
weil die Polizei nachts Säuglinge in Obhut geben konnte«<br />
hieß es 1977 im Jugendamt. 412 Da man für sie jetzt eine Lösung<br />
durch Übergangspflegestellen geschaffen hatte, war die Aufrechterhaltung<br />
des Betriebs nicht mehr begründbar und das<br />
Säuglingsheim wurde im Mai 1977 geschlossen.<br />
Entwicklungen in den weiteren<br />
Bremerhavener Heimen<br />
Als das Mädchenheim Wichernhaus des Diakonischen Werks<br />
in Bremerhaven 1963 sein zehnjähriges Jubiläum feierte, war es<br />
bereits »Zufluchtsort für 925 Mädchen in bedrängter Lage (drohende<br />
Verwahrlosung, vor die Tür gesetzt wegen Schwangerschaft;<br />
Ausreißerinnen und Strafentlassene, die nicht wissen<br />
wohin)« gewesen. 413 Neben den jugendlichen Mädchen lebten<br />
weiterhin auch jüngere Kinder im Heim. Ob die Mischung zwischen<br />
Kindern und den Jugendlichen ratsam sei, war bereits<br />
1960, in diesem Jahr mit der Empfehlung, keine Kinder mehr<br />
aufzunehmen, diskutiert worden. 1964 plädierte man dann<br />
dafür, aus der Not eine Tugend zu machen und das Heim künftig<br />
mit zwei Abteilungen, eine für Kinder und die andere für<br />
Jugendliche, zu führen. 414 Die Trennung in zwei Gruppen war<br />
spätestens 1972 vollzogen. Sie bewährte sich aber nicht, da eine<br />
wirkliche Trennung nach Gruppen in dem über zwei Stockwerke<br />
verteilten Wohnraum faktisch nicht möglich war. Man zog die<br />
Konsequenzen daraus, indem man die Platzzahl auf 16 Plätze<br />
reduzierte und das Heim wieder als eine Gruppe für 14- bis<br />
18-jährige Mädchen führte.<br />
Motor für Reformen wurde ab 1974 die neue Heimleiterin, eine<br />
gelernte Sozialarbeiterin. Ihr gelang es, ein Jahr später eine<br />
zweite Sozialarbeiterin für die pädagogische Arbeit zu gewinnen.<br />
Zur Aufgabe der beiden Pädagoginnen wurde es, mit den<br />
neuen pädagogischen Problemen umzugehen. Dazu gehörte,<br />
dass es immer seltener gelang, den oft lernschwachen Mädchen<br />
eine reguläre Ausbildungsstelle zu verschaffen. Außerdem<br />
vermehrten sich disziplinarische Probleme. 415<br />
Das Lehrlingswohnheim der Arbeiterwohlfahrt in Bremerhaven<br />
behielt seine in den 1950er Jahren geprägte Gestalt bis<br />
1973. In diesem Jahr kam es zur Fertigstellung eines die Villa<br />
ergänzenden Neubaus bei gleichzeitiger Reduzierung der<br />
Gesamtzahl. Zudem begann man damit, neben den Lehrlingen<br />
Schüler aufzunehmen, was die Anstellung von mehr pädagogischem<br />
Personal erforderte. 416 Vor allem aber gab man sich eine<br />
neue, ausdrücklich an den Prinzipien des demokratischen Sozialismus<br />
der Arbeiterwohlfahrt orientierte Konzeption: »Vertiefung<br />
der Demokratie, Humanisierung der Gesellschaft, Verstärkung<br />
der Freiheit und der Bildung des Einzelnen, Verbreitung eines<br />
partnerschaftlichen Verhaltens von Mensch zu Mensch und der<br />
Bereitschaft und Fähigkeit aller, den Schwachen zu helfen.« 417 Für<br />
die konkrete Umsetzung wurden »Richtlinien zur pädagogischen<br />
Praxis des Lehrlingswohnheims« erlassen. Sie enthielten<br />
einige Forderungen, die andere Heime erst einige Jahre später<br />
aufgriffen. Zu diesen zählten – neben allgemeinen Prinzipien<br />
für einen bedürfnisgerechten und empathischen Umgang mit<br />
den Jugendlichen – beispielsweise auch Beschwerderechte und<br />
das Recht auf tarifliche Bezahlung auch innerhalb einer (befristeten)<br />
Beschäftigung im Heim.<br />
107