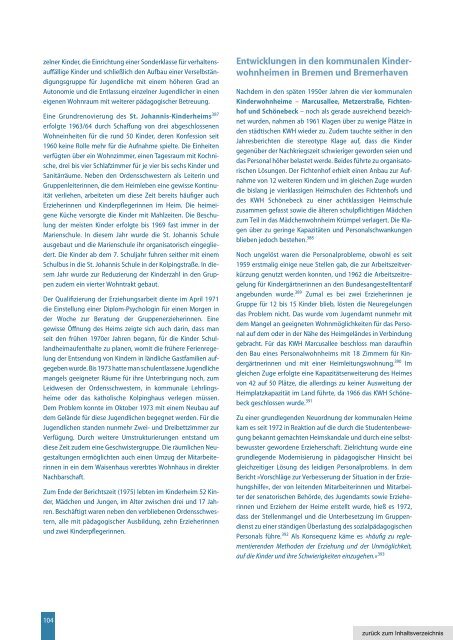1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zelner Kinder, die Einrichtung einer Sonderklasse für verhaltensauffällige<br />
Kinder und schließlich den Aufbau einer Verselbständigungsgruppe<br />
für Jugendliche mit einem höheren Grad an<br />
Autonomie und die Entlassung einzelner Jugendlicher in einen<br />
eigenen Wohnraum mit weiterer pädagogischer Betreuung.<br />
Eine Grundrenovierung des St. Johannis-Kinderheims 387<br />
erfolgte 1963/64 durch Schaffung von drei abgeschlossenen<br />
Wohneinheiten für die rund 50 Kinder, deren Konfession seit<br />
1960 keine Rolle mehr für die Aufnahme spielte. Die Einheiten<br />
verfügten über ein Wohnzimmer, einen Tagesraum mit Kochnische,<br />
drei bis vier Schlafzimmer für je vier bis sechs Kinder und<br />
Sanitärräume. Neben den Ordensschwestern als Leiterin und<br />
Gruppenleiterinnen, die dem Heimleben eine gewisse Kontinuität<br />
verliehen, arbeiteten um diese Zeit bereits häufiger auch<br />
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen im Heim. Die heimeigene<br />
Küche versorgte die Kinder mit Mahlzeiten. Die Beschulung<br />
der meisten Kinder erfolgte bis 1969 fast immer in der<br />
Marienschule. In diesem Jahr wurde die St. Johannis Schule<br />
ausgebaut und die Marienschule ihr organisatorisch eingegliedert.<br />
Die Kinder ab dem 7. Schuljahr fuhren seither mit einem<br />
Schulbus in die St. Johannis Schule in der Kolpingstraße. In diesem<br />
Jahr wurde zur Reduzierung der Kinderzahl in den Gruppen<br />
zudem ein vierter Wohntrakt gebaut.<br />
Der Qualifizierung der Erziehungsarbeit diente im April 1971<br />
die Einstellung einer Diplom-Psychologin für einen Morgen in<br />
der Woche zur Beratung der Gruppenerzieherinnen. Eine<br />
gewisse Öffnung des Heims zeigte sich auch darin, dass man<br />
seit den frühen 1970er Jahren begann, für die Kinder Schullandheimaufenthalte<br />
zu planen, womit die frühere Ferienregelung<br />
der Entsendung von Kindern in ländliche Gastfamilien aufgegeben<br />
wurde. Bis 1973 hatte man schulentlassene Jugendliche<br />
mangels geeigneter Räume für ihre Unterbringung noch, zum<br />
Leidwesen der Ordensschwestern, in kommunale Lehrlingsheime<br />
oder das katholische Kolpinghaus verlegen müssen.<br />
Dem Problem konnte im Oktober 1973 mit einem Neubau auf<br />
dem Gelände für diese Jugendlichen begegnet werden. Für die<br />
Jugendlichen standen nunmehr Zwei- und Dreibettzimmer zur<br />
Verfügung. Durch weitere Umstrukturierungen entstand um<br />
diese Zeit zudem eine Geschwistergruppe. Die räumlichen Neugestaltungen<br />
ermöglichten auch einen Umzug der Mitarbeiterinnen<br />
in ein dem Waisenhaus vererbtes Wohnhaus in direkter<br />
Nachbarschaft.<br />
Zum Ende der Berichtszeit (1975) lebten im Kinderheim 52 Kinder,<br />
Mädchen und Jungen, im Alter zwischen drei und 17 Jahren.<br />
Beschäftigt waren neben den verbliebenen Ordensschwestern,<br />
alle mit pädagogischer Ausbildung, zehn Erzieherinnen<br />
und zwei Kinderpflegerinnen.<br />
Entwicklungen in den kommunalen Kinderwohnheimen<br />
in Bremen und Bremerhaven<br />
Nachdem in den späten 1950er Jahren die vier kommunalen<br />
Kinderwohnheime – Marcusallee, Metzerstraße, Fichtenhof<br />
und Schönebeck – noch als gerade ausreichend bezeichnet<br />
wurden, nahmen ab 1961 Klagen über zu wenige Plätze in<br />
den städtischen KWH wieder zu. Zudem tauchte seither in den<br />
Jahresberichten die stereotype Klage auf, dass die Kinder<br />
gegenüber der Nachkriegszeit schwieriger geworden seien und<br />
das Personal höher belastet werde. Beides führte zu organisatorischen<br />
Lösungen. Der Fichtenhof erhielt einen Anbau zur Aufnahme<br />
von 12 weiteren Kindern und im gleichen Zuge wurden<br />
die bislang je vierklassigen Heimschulen des Fichtenhofs und<br />
des KWH Schönebeck zu einer achtklassigen Heimschule<br />
zusammen gefasst sowie die älteren schulpflichtigen Mädchen<br />
zum Teil in das Mädchenwohnheim Krümpel verlagert. Die Klagen<br />
über zu geringe Kapazitäten und Personalschwankungen<br />
blieben jedoch bestehen. 388<br />
Noch ungelöst waren die Personalprobleme, obwohl es seit<br />
1959 erstmalig einige neue Stellen gab, die zur Arbeitszeitverkürzung<br />
genutzt werden konnten, und 1962 die Arbeitszeitregelung<br />
für Kindergärtnerinnen an den Bundesangestelltentarif<br />
angebunden wurde. 389 Zumal es bei zwei Erzieherinnen je<br />
Gruppe für 12 bis 15 Kinder blieb, lösten die Neuregelungen<br />
das Problem nicht. Das wurde vom Jugendamt nunmehr mit<br />
dem Mangel an geeigneten Wohnmöglichkeiten für das Personal<br />
auf dem oder in der Nähe des Heimgeländes in Verbindung<br />
gebracht. Für das KWH Marcusallee beschloss man daraufhin<br />
den Bau eines Personalwohnheims mit 18 Zimmern für Kindergärtnerinnen<br />
und mit einer Heimleitungswohnung. 390 Im<br />
gleichen Zuge erfolgte eine Kapazitätserweiterung des Heimes<br />
von 42 auf 50 Plätze, die allerdings zu keiner Ausweitung der<br />
Heimplatzkapazität im Land führte, da 1966 das KWH Schönebeck<br />
geschlossen wurde. 391<br />
Zu einer grundlegenden Neuordnung der kommunalen Heime<br />
kam es seit 1972 in Reaktion auf die durch die Studentenbewegung<br />
bekannt gemachten Heimskandale und durch eine selbstbewusster<br />
gewordene Erzieherschaft. Zielrichtung wurde eine<br />
grundlegende Modernisierung in pädagogischer Hinsicht bei<br />
gleichzeitiger Lösung des leidigen Personalproblems. In dem<br />
Bericht »Vorschläge zur Verbesserung der Situation in der Erziehungshilfe«,<br />
der von leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
der senatorischen Behörde, des Jugendamts sowie Erzieherinnen<br />
und Erziehern der Heime erstellt wurde, hieß es 1972,<br />
dass der Stellenmangel und die Unterbesetzung im Gruppendienst<br />
zu einer ständigen Überlastung des sozialpädagogischen<br />
Personals führe. 392 Als Konsequenz käme es »häufig zu reglementierenden<br />
Methoden der Erziehung und der Unmöglichkeit,<br />
auf die Kinder und ihre Schwierigkeiten einzugehen.« 393<br />
104