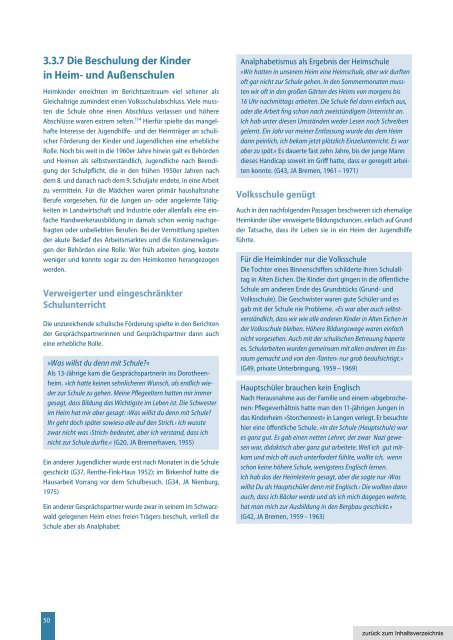1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.3.7 Die Beschulung der Kinder<br />
in Heim- und Außenschulen<br />
Heimkinder erreichten im Berichtszeitraum viel seltener als<br />
Gleichaltrige zumindest einen Volksschulabschluss. Viele mussten<br />
die Schule ohne einen Abschluss verlassen und höhere<br />
Abschlüsse waren extrem selten. 114 Hierfür spielte das mangelhafte<br />
Interesse der Jugendhilfe- und der Heimträger an schulischer<br />
Förderung der Kinder und Jugendlichen eine erhebliche<br />
Rolle. Noch bis weit in die 1960er Jahre hinein galt es Behörden<br />
und Heimen als selbstverständlich, Jugendliche nach Beendigung<br />
der Schulpflicht, die in den frühen 1950er Jahren nach<br />
dem 8. und danach nach dem 9. Schuljahr endete, in eine Arbeit<br />
zu vermitteln. Für die Mädchen waren primär haushaltsnahe<br />
Berufe vorgesehen, für die Jungen un- oder angelernte Tätigkeiten<br />
in Landwirtschaft und Industrie oder allenfalls eine einfache<br />
Handwerkerausbildung in damals schon wenig nachgefragten<br />
oder unbeliebten Berufen. Bei der Vermittlung spielten<br />
der akute Bedarf des Arbeitsmarktes und die Kostenerwägungen<br />
der Behörden eine Rolle: Wer früh arbeiten ging, kostete<br />
weniger und konnte sogar zu den Heimkosten herangezogen<br />
werden.<br />
Verweigerter und eingeschränkter<br />
Schulunterricht<br />
Die unzureichende schulische Förderung spielte in den Berichten<br />
der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dann auch<br />
eine erhebliche Rolle.<br />
»Was willst du denn mit Schule«<br />
Als 13-Jährige kam die Gesprächspartnerin ins Dorotheenheim.<br />
»Ich hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als endlich wieder<br />
zur Schule zu gehen. Meine Pflegeeltern hatten mir immer<br />
gesagt, dass Bildung das Wichtigste im Leben ist. Die Schwester<br />
im Heim hat mir aber gesagt: ›Was willst du denn mit Schule<br />
Ihr geht doch später sowieso alle auf den Strich.‹ Ich wusste<br />
zwar nicht was ›Strich‹ bedeutet, aber ich verstand, dass ich<br />
nicht zur Schule durfte.« (G20, JA Bremerhaven, 1955)<br />
Ein anderer Jugendlicher wurde erst nach Monaten in die Schule<br />
geschickt (G37, Renthe-Fink-Haus 1952); im Birkenhof hatte die<br />
Hausarbeit Vorrang vor dem Schulbesuch. (G34, JA Nienburg,<br />
1975)<br />
Ein anderer Gesprächspartner wurde zwar in seinem im Schwarzwald<br />
gelegenen Heim eines freien Trägers beschult, verließ die<br />
Schule aber als Analphabet:<br />
Analphabetismus als Ergebnis der Heimschule<br />
»Wir hatten in unserem Heim eine Heimschule, aber wir durften<br />
oft gar nicht zur Schule gehen. In den Sommermonaten mussten<br />
wir oft in den großen Gärten des Heims von morgens bis<br />
16 Uhr nachmittags arbeiten. Die Schule fiel dann einfach aus,<br />
oder die Arbeit fing schon nach zweistündigem Unterricht an.<br />
Ich hab unter diesen Umständen weder Lesen noch Schreiben<br />
gelernt. Ein Jahr vor meiner Entlassung wurde das dem Heim<br />
dann peinlich, ich bekam jetzt plötzlich Einzelunterricht. Es war<br />
aber zu spät.« Es dauerte fast zehn Jahre, bis der junge Mann<br />
dieses Handicap soweit im Griff hatte, dass er geregelt arbeiten<br />
konnte. (G43, JA Bremen, 1961 – 1971)<br />
Volksschule genügt<br />
Auch in den nachfolgenden Passagen beschweren sich ehemalige<br />
Heimkinder über verweigerte Bildungschancen, einfach auf Grund<br />
der Tatsache, dass ihr Leben sie in ein Heim der Jugendhilfe<br />
führte.<br />
Für die Heimkinder nur die Volksschule<br />
Die Tochter eines Binnenschiffers schilderte ihren Schulalltag<br />
in Alten Eichen. Die Kinder dort gingen in die öffentliche<br />
Schule am anderen Ende des Grundstücks (Grund- und<br />
Volksschule). Die Geschwister waren gute Schüler und es<br />
gab mit der Schule nie Probleme. »Es war aber auch selbstverständlich,<br />
dass wir wie alle anderen Kinder in Alten Eichen in<br />
der Volksschule bleiben. Höhere Bildungswege waren einfach<br />
nicht vorgesehen. Auch mit der schulischen Betreuung haperte<br />
es. Schularbeiten wurden gemeinsam mit allen anderen im Essraum<br />
gemacht und von den ›Tanten‹ nur grob beaufsichtigt.«<br />
(G49, private Unterbringung, 1959 – 1969)<br />
Hauptschüler brauchen kein Englisch<br />
Nach Herausnahme aus der Familie und einem ›abgebrochenen‹<br />
Pflegeverhältnis hatte man den 11-jährigen Jungen in<br />
das Kinderheim »Storchennest« in Langen verlegt. Er besuchte<br />
hier eine öffentliche Schule. »In der Schule (Hauptschule) war<br />
es ganz gut. Es gab einen netten Lehrer, der zwar Nazi gewesen<br />
war, didaktisch aber ganz gut arbeitete. Weil ich gut mitkam<br />
und mich oft auch unterfordert fühlte, wollte ich, wenn<br />
schon keine höhere Schule, wenigstens Englisch lernen.<br />
Ich hab das der Heimleiterin gesagt, aber die sagte nur ›Was<br />
willst Du als Hauptschüler denn mit Englisch.‹ Die wollten dann<br />
auch, dass ich Bäcker werde und als ich mich dagegen wehrte,<br />
hat man mich zur Ausbildung in den Bergbau geschickt.«<br />
(G42, JA Bremen, 1959 – 1963)<br />
50