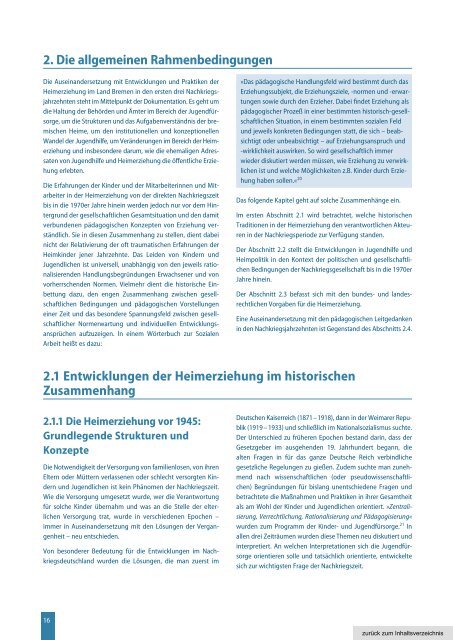1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Die allgemeinen Rahmenbedingungen<br />
Die Auseinandersetzung mit Entwicklungen und Praktiken der<br />
Heimerziehung im Land Bremen in den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten<br />
steht im Mittelpunkt der Dokumentation. Es geht um<br />
die Haltung der Behörden und Ämter im Bereich der Jugendfürsorge,<br />
um die Strukturen und das Aufgabenverständnis der bremischen<br />
Heime, um den institutionellen und konzeptionellen<br />
Wandel der Jugendhilfe, um Veränderungen im Bereich der Heimerziehung<br />
und insbesondere darum, wie die ehemaligen Adressaten<br />
von Jugendhilfe und Heimerziehung die öffentliche Erziehung<br />
erlebten.<br />
Die Erfahrungen der Kinder und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
in der Heimerziehung von der direkten Nachkriegszeit<br />
bis in die 1970er Jahre hinein werden jedoch nur vor dem Hintergrund<br />
der gesellschaftlichen Gesamtsituation und den damit<br />
verbundenen pädagogischen Konzepten von Erziehung verständlich.<br />
Sie in diesen Zusammenhang zu stellen, dient dabei<br />
nicht der Relativierung der oft traumatischen Erfahrungen der<br />
Heimkinder jener Jahrzehnte. Das Leiden von Kindern und<br />
Jugendlichen ist universell, unabhängig von den jeweils rationalisierenden<br />
Handlungsbegründungen Erwachsener und von<br />
vorherrschenden Normen. Vielmehr dient die historische Einbettung<br />
dazu, den engen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen<br />
Bedingungen und pädagogischen Vorstellungen<br />
einer Zeit und das besondere Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher<br />
Normerwartung und individuellen Entwicklungsansprüchen<br />
aufzuzeigen. In einem Wörterbuch zur Sozialen<br />
Arbeit heißt es dazu:<br />
»Das pädagogische Handlungsfeld wird bestimmt durch das<br />
Erziehungssubjekt, die Erziehungsziele, -normen und -erwartungen<br />
sowie durch den Erzieher. Dabei findet Erziehung als<br />
pädagogischer Prozeß in einer bestimmten historisch-gesellschaftlichen<br />
Situation, in einem bestimmten sozialen Feld<br />
und jeweils konkreten Bedingungen statt, die sich – beabsichtigt<br />
oder unbeabsichtigt – auf Erziehungsanspruch und<br />
-wirklichkeit auswirken. So wird gesellschaftlich immer<br />
wieder diskutiert werden müssen, wie Erziehung zu verwirklichen<br />
ist und welche Möglichkeiten z.B. Kinder durch Erziehung<br />
haben sollen.« 20<br />
Das folgende Kapitel geht auf solche Zusammenhänge ein.<br />
Im ersten Abschnitt 2.1 wird betrachtet, welche historischen<br />
Traditionen in der Heimerziehung den verantwortlichen Akteuren<br />
in der Nachkriegsperiode zur Verfügung standen.<br />
Der Abschnitt 2.2 stellt die Entwicklungen in Jugendhilfe und<br />
Heimpolitik in den Kontext der politischen und gesellschaftlichen<br />
Bedingungen der Nachkriegsgesellschaft bis in die 1970er<br />
Jahre hinein.<br />
Der Abschnitt 2.3 befasst sich mit den bundes- und landesrechtlichen<br />
Vorgaben für die Heimerziehung.<br />
Eine Auseinandersetzung mit den pädagogischen Leitgedanken<br />
in den Nachkriegsjahrzehnten ist Gegenstand des Abschnitts 2.4.<br />
2.1 Entwicklungen der Heimerziehung im historischen<br />
Zusammenhang<br />
2.1.1 Die Heimerziehung vor 1945:<br />
Grundlegende Strukturen und<br />
Konzepte<br />
Die Notwendigkeit der Versorgung von familienlosen, von ihren<br />
Eltern oder Müttern verlassenen oder schlecht versorgten Kindern<br />
und Jugendlichen ist kein Phänomen der Nachkriegszeit.<br />
Wie die Versorgung umgesetzt wurde, wer die Verantwortung<br />
für solche Kinder übernahm und was an die Stelle der elterlichen<br />
Versorgung trat, wurde in verschiedenen Epochen –<br />
immer in Auseinandersetzung mit den Lösungen der Vergangenheit<br />
– neu entschieden.<br />
Von besonderer Bedeutung für die Entwicklungen im Nachkriegsdeutschland<br />
wurden die Lösungen, die man zuerst im<br />
Deutschen Kaiserreich (1871 – 1918), dann in der Weimarer Republik<br />
(1919 – 1933) und schließlich im Nationalsozialismus suchte.<br />
Der Unterschied zu früheren Epochen bestand darin, dass der<br />
Gesetzgeber im ausgehenden 19. Jahrhundert begann, die<br />
alten Fragen in für das ganze Deutsche Reich verbindliche<br />
gesetzliche Regelungen zu gießen. Zudem suchte man zunehmend<br />
nach wissenschaftlichen (oder pseudowissenschaftlichen)<br />
Begründungen für bislang unentschiedene Fragen und<br />
betrachtete die Maßnahmen und Praktiken in ihrer Gesamtheit<br />
als am Wohl der Kinder und Jugendlichen orientiert. »Zentralisierung,<br />
Verrechtlichung, Rationalisierung und Pädagogisierung«<br />
wurden zum Programm der Kinder- und Jugendfürsorge. 21 In<br />
allen drei Zeiträumen wurden diese Themen neu diskutiert und<br />
interpretiert. An welchen Interpretationen sich die Jugendfürsorge<br />
orientieren solle und tatsächlich orientierte, entwickelte<br />
sich zur wichtigsten Frage der Nachkriegszeit.<br />
16