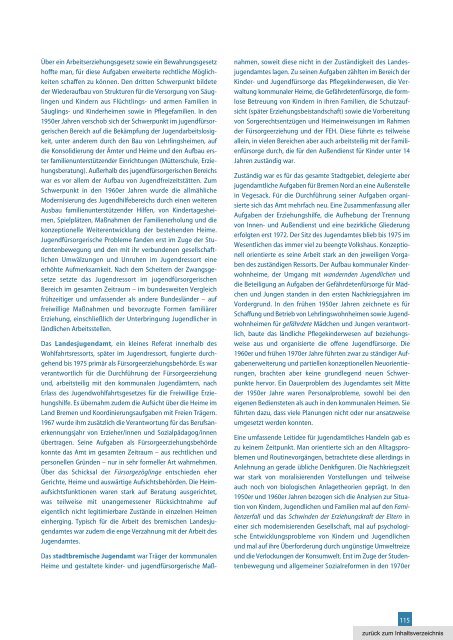1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Über ein Arbeitserziehungsgesetz sowie ein Bewahrungsgesetz<br />
hoffte man, für diese Aufgaben erweiterte rechtliche Möglichkeiten<br />
schaffen zu können. Den dritten Schwerpunkt bildete<br />
der Wiederaufbau von Strukturen für die Versorgung von Säuglingen<br />
und Kindern aus Flüchtlings- und armen Familien in<br />
Säuglings- und Kinderheimen sowie in Pflegefamilien. In den<br />
1950er Jahren verschob sich der Schwerpunkt im jugendfürsorgerischen<br />
Bereich auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit,<br />
unter anderem durch den Bau von Lehrlingsheimen, auf<br />
die Konsolidierung der Ämter und Heime und den Aufbau erster<br />
familienunterstützender Einrichtungen (Mütterschule, Erziehungsberatung).<br />
Außerhalb des jugendfürsorgerischen Bereichs<br />
war es vor allem der Aufbau von Jugendfreizeitstätten. Zum<br />
Schwerpunkt in den 1960er Jahren wurde die allmähliche<br />
Modernisierung des Jugendhilfebereichs durch einen weiteren<br />
Ausbau familienunterstützender Hilfen, von Kindertagesheimen,<br />
Spielplätzen, Maßnahmen der Familienerholung und die<br />
konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden Heime.<br />
Jugendfürsorgerische Probleme fanden erst im Zuge der Studentenbewegung<br />
und den mit ihr verbundenen gesellschaftlichen<br />
Umwälzungen und Unruhen im Jugendressort eine<br />
erhöhte Aufmerksamkeit. Nach dem Scheitern der Zwangsgesetze<br />
setzte das Jugendressort im jugendfürsorgerischen<br />
Bereich im gesamten Zeitraum – im bundesweiten Vergleich<br />
frühzeitiger und umfassender als andere Bundesländer – auf<br />
freiwillige Maßnahmen und bevorzugte Formen familiärer<br />
Erziehung, einschließlich der Unterbringung Jugendlicher in<br />
ländlichen Arbeitsstellen.<br />
Das Landesjugendamt, ein kleines Referat innerhalb des<br />
Wohlfahrtsressorts, später im Jugendressort, fungierte durchgehend<br />
bis 1975 primär als Fürsorgeerziehungsbehörde. Es war<br />
verantwortlich für die Durchführung der Fürsorgeerziehung<br />
und, arbeitsteilig mit den kommunalen Jugendämtern, nach<br />
Erlass des Jugendwohlfahrtsgesetzes für die Freiwillige Erziehungshilfe.<br />
Es übernahm zudem die Aufsicht über die Heime im<br />
Land Bremen und Koordinierungsaufgaben mit Freien Trägern.<br />
1967 wurde ihm zusätzlich die Verantwortung für das Berufsanerkennungsjahr<br />
von Erzieher/innen und Sozialpädagog/innen<br />
übertragen. Seine Aufgaben als Fürsorgeerziehungsbehörde<br />
konnte das Amt im gesamten Zeitraum – aus rechtlichen und<br />
personellen Gründen – nur in sehr formeller Art wahrnehmen.<br />
Über das Schicksal der Fürsorgezöglinge entschieden eher<br />
Gerichte, Heime und auswärtige Aufsichtsbehörden. Die Heimaufsichtsfunktionen<br />
waren stark auf Beratung ausgerichtet,<br />
was teilweise mit unangemessener Rücksichtnahme auf<br />
eigentlich nicht legitimierbare Zustände in einzelnen Heimen<br />
einherging. Typisch für die Arbeit des bremischen Landesjugendamtes<br />
war zudem die enge Verzahnung mit der Arbeit des<br />
Jugendamtes.<br />
Das stadtbremische Jugendamt war Träger der kommunalen<br />
Heime und gestaltete kinder- und jugendfürsorgerische Maßnahmen,<br />
soweit diese nicht in der Zuständigkeit des Landesjugendamtes<br />
lagen. Zu seinen Aufgaben zählten im Bereich der<br />
Kinder- und Jugendfürsorge das Pflegekinderwesen, die Verwaltung<br />
kommunaler Heime, die Gefährdetenfürsorge, die formlose<br />
Betreuung von Kindern in ihren Familien, die Schutzaufsicht<br />
(später Erziehungsbeistandschaft) sowie die Vorbereitung<br />
von Sorgerechtsentzügen und Heimeinweisungen im Rahmen<br />
der Fürsorgeerziehung und der FEH. Diese führte es teilweise<br />
allein, in vielen Bereichen aber auch arbeitsteilig mit der Familienfürsorge<br />
durch, die für den Außendienst für Kinder unter 14<br />
Jahren zuständig war.<br />
Zuständig war es für das gesamte Stadtgebiet, delegierte aber<br />
jugendamtliche Aufgaben für Bremen Nord an eine Außenstelle<br />
in Vegesack. Für die Durchführung seiner Aufgaben organisierte<br />
sich das Amt mehrfach neu. Eine Zusammenfassung aller<br />
Aufgaben der Erziehungshilfe, die Aufhebung der Trennung<br />
von Innen- und Außendienst und eine bezirkliche Gliederung<br />
erfolgten erst 1972. Der Sitz des Jugendamtes blieb bis 1975 im<br />
Wesentlichen das immer viel zu beengte Volkshaus. Konzeptionell<br />
orientierte es seine Arbeit stark an den jeweiligen Vorgaben<br />
des zuständigen Ressorts. Der Aufbau kommunaler Kinderwohnheime,<br />
der Umgang mit wandernden Jugendlichen und<br />
die Beteiligung an Aufgaben der Gefährdetenfürsorge für Mädchen<br />
und Jungen standen in den ersten Nachkriegsjahren im<br />
Vordergrund. In den frühen 1950er Jahren zeichnete es für<br />
Schaffung und Betrieb von Lehrlingswohnheimen sowie Jugendwohnheimen<br />
für gefährdete Mädchen und Jungen verantwortlich,<br />
baute das ländliche Pflegekinderwesen auf beziehungsweise<br />
aus und organisierte die offene Jugendfürsorge. Die<br />
1960er und frühen 1970er Jahre führten zwar zu ständiger Aufgabenerweiterung<br />
und partiellen konzeptionellen Neuorientierungen,<br />
brachten aber keine grundlegend neuen Schwerpunkte<br />
hervor. Ein Dauerproblem des Jugendamtes seit Mitte<br />
der 1950er Jahre waren Personalprobleme, sowohl bei den<br />
eigenen Bediensteten als auch in den kommunalen Heimen. Sie<br />
führten dazu, dass viele Planungen nicht oder nur ansatzweise<br />
umgesetzt werden konnten.<br />
Eine umfassende Leitidee für jugendamtliches Handeln gab es<br />
zu keinem Zeitpunkt. Man orientierte sich an den Alltagsproblemen<br />
und Routinevorgängen, betrachtete diese allerdings in<br />
Anlehnung an gerade übliche Denkfiguren. Die Nachkriegszeit<br />
war stark von moralisierenden Vorstellungen und teilweise<br />
auch noch von biologischen Anlagetheorien geprägt. In den<br />
1950er und 1960er Jahren bezogen sich die Analysen zur Situation<br />
von Kindern, Jugendlichen und Familien mal auf den Familienzerfall<br />
und das Schwinden der Erziehungskraft der Eltern in<br />
einer sich modernisierenden Gesellschaft, mal auf psychologische<br />
Entwicklungsprobleme von Kindern und Jugendlichen<br />
und mal auf ihre Überforderung durch ungünstige Umweltreize<br />
und die Verlockungen der Konsumwelt. Erst im Zuge der Studentenbewegung<br />
und allgemeiner Sozialreformen in den 1970er<br />
115