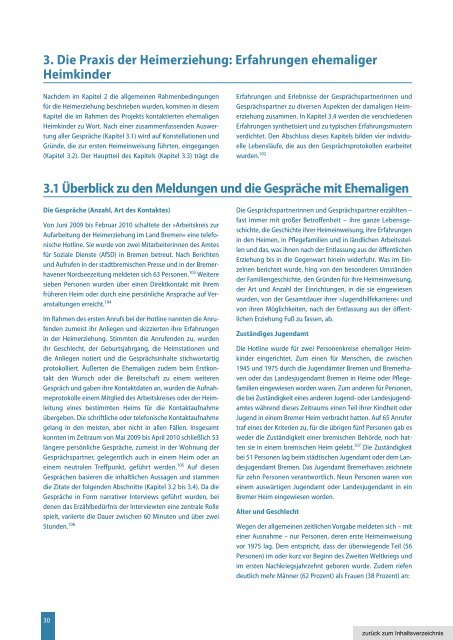1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Die Praxis der Heimerziehung: Erfahrungen ehemaliger<br />
Heimkinder<br />
Nachdem im Kapitel 2 die allgemeinen Rahmenbedingungen<br />
für die Heimerziehung beschrieben wurden, kommen in diesem<br />
Kapitel die im Rahmen des Projekts kontaktierten ehemaligen<br />
Heimkinder zu Wort. Nach einer zusammenfassenden Auswertung<br />
aller Gespräche (Kapitel 3.1) wird auf Konstellationen und<br />
Gründe, die zur ersten Heimeinweisung führten, eingegangen<br />
(Kapitel 3.2). Der Hauptteil des Kapitels (Kapitel 3.3) trägt die<br />
Erfahrungen und Erlebnisse der Gesprächspartnerinnen und<br />
Gesprächspartner zu diversen Aspekten der damaligen Heimerziehung<br />
zusammen. In Kapitel 3.4 werden die verschiedenen<br />
Erfahrungen synthetisiert und zu typischen Erfahrungsmustern<br />
verdichtet. Den Abschluss dieses Kapitels bilden vier individuelle<br />
Lebensläufe, die aus den Gesprächsprotokollen erarbeitet<br />
wurden. 102<br />
3.1 Überblick zu den Meldungen und die Gespräche mit Ehemaligen<br />
Die Gespräche (Anzahl, Art des Kontaktes)<br />
Von Juni 2009 bis Februar 2010 schaltete der »Arbeitskreis zur<br />
Aufarbeitung der Heimerziehung im Land Bremen« eine telefonische<br />
Hotline. Sie wurde von zwei Mitarbeiterinnen des Amtes<br />
für Soziale Dienste (AfSD) in Bremen betreut. Nach Berichten<br />
und Aufrufen in der stadtbremischen Presse und in der Bremerhavener<br />
Nordseezeitung meldeten sich 63 Personen. 103 Weitere<br />
sieben Personen wurden über einen Direktkontakt mit ihrem<br />
früheren Heim oder durch eine persönliche Ansprache auf Veranstaltungen<br />
erreicht. 104<br />
Im Rahmen des ersten Anrufs bei der Hotline nannten die Anrufenden<br />
zumeist ihr Anliegen und skizzierten ihre Erfahrungen<br />
in der Heimerziehung. Stimmten die Anrufenden zu, wurden<br />
ihr Geschlecht, der Geburtsjahrgang, die Heimstationen und<br />
die Anliegen notiert und die Gesprächsinhalte stichwortartig<br />
protokolliert. Äußerten die Ehemaligen zudem beim Erstkontakt<br />
den Wunsch oder die Bereitschaft zu einem weiteren<br />
Gespräch und gaben ihre Kontaktdaten an, wurden die Aufnahmeprotokolle<br />
einem Mitglied des Arbeitskreises oder der Heimleitung<br />
eines bestimmten Heims für die Kontaktaufnahme<br />
übergeben. Die schriftliche oder telefonische Kontaktaufnahme<br />
gelang in den meisten, aber nicht in allen Fällen. Insgesamt<br />
konnten im Zeitraum von Mai 2009 bis April 2010 schließlich 53<br />
längere persönliche Gespräche, zumeist in der Wohnung der<br />
Gesprächspartner, gelegentlich auch in einem Heim oder an<br />
einem neutralen Treffpunkt, geführt werden. 105 Auf diesen<br />
Gesprächen basieren die inhaltlichen Aussagen und stammen<br />
die Zitate der folgenden Abschnitte (Kapitel 3.2 bis 3.4). Da die<br />
Gespräche in Form narrativer Interviews geführt wurden, bei<br />
denen das Erzählbedürfnis der Interviewten eine zentrale Rolle<br />
spielt, variierte die Dauer zwischen 60 Minuten und über zwei<br />
Stunden. 106<br />
Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erzählten –<br />
fast immer mit großer Betroffenheit – ihre ganze Lebensgeschichte,<br />
die Geschichte ihrer Heimeinweisung, ihre Erfahrungen<br />
in den Heimen, in Pflegefamilien und in ländlichen Arbeitsstellen<br />
und das, was ihnen nach der Entlassung aus der öffentlichen<br />
Erziehung bis in die Gegenwart hinein widerfuhr. Was im Einzelnen<br />
berichtet wurde, hing von den besonderen Umständen<br />
der Familiengeschichte, den Gründen für ihre Heimeinweisung,<br />
der Art und Anzahl der Einrichtungen, in die sie eingewiesen<br />
wurden, von der Gesamtdauer ihrer »Jugendhilfekarriere« und<br />
von ihren Möglichkeiten, nach der Entlassung aus der öffentlichen<br />
Erziehung Fuß zu fassen, ab.<br />
Zuständiges Jugendamt<br />
Die Hotline wurde für zwei Personenkreise ehemaliger Heimkinder<br />
eingerichtet. Zum einen für Menschen, die zwischen<br />
1945 und 1975 durch die Jugendämter Bremen und Bremerhaven<br />
oder das Landesjugendamt Bremen in Heime oder Pflegefamilien<br />
eingewiesen worden waren. Zum anderen für Personen,<br />
die bei Zuständigkeit eines anderen Jugend- oder Landesjugendamtes<br />
während dieses Zeitraums einen Teil ihrer Kindheit oder<br />
Jugend in einem Bremer Heim verbracht hatten. Auf 65 Anrufer<br />
traf eines der Kriterien zu, für die übrigen fünf Personen gab es<br />
weder die Zuständigkeit einer bremischen Behörde, noch hatten<br />
sie in einem bremischen Heim gelebt. 107 Die Zuständigkeit<br />
bei 51 Personen lag beim städtischen Jugendamt oder dem Landesjugendamt<br />
Bremen. Das Jugendamt Bremerhaven zeichnete<br />
für zehn Personen verantwortlich. Neun Personen waren von<br />
einem auswärtigen Jugendamt oder Landesjugendamt in ein<br />
Bremer Heim eingewiesen worden.<br />
Alter und Geschlecht<br />
Wegen der allgemeinen zeitlichen Vorgabe meldeten sich – mit<br />
einer Ausnahme – nur Personen, deren erste Heimeinweisung<br />
vor 1975 lag. Dem entspricht, dass der überwiegende Teil (56<br />
Personen) im oder kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs und<br />
im ersten Nachkriegsjahrzehnt geboren wurde. Zudem riefen<br />
deutlich mehr Männer (62 Prozent) als Frauen (38 Prozent) an:<br />
30