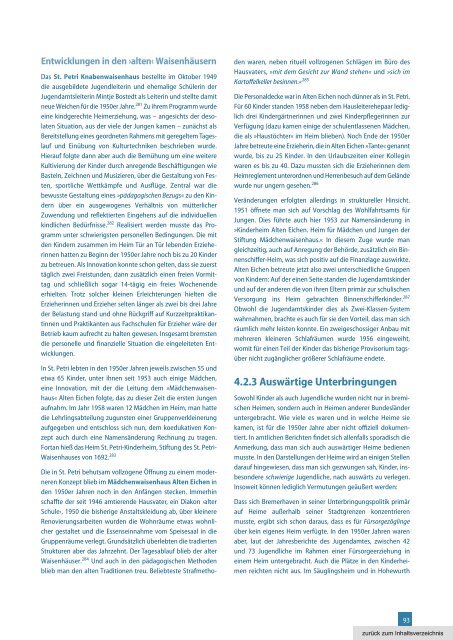1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Entwicklungen in den ›alten‹ Waisenhäusern<br />
Das St. Petri Knabenwaisenhaus bestellte im Oktober 1949<br />
die ausgebildete Jugendleiterin und ehemalige Schülerin der<br />
Jugendamtsleiterin Mintje Bostedt als Leiterin und stellte damit<br />
neue Weichen für die 1950er Jahre. 281 Zu ihrem Programm wurde<br />
eine kindgerechte Heimerziehung, was – angesichts der desolaten<br />
Situation, aus der viele der Jungen kamen – zunächst als<br />
Bereitstellung eines geordneten Rahmens mit geregeltem Tageslauf<br />
und Einübung von Kulturtechniken beschrieben wurde.<br />
Hierauf folgte dann aber auch die Bemühung um eine weitere<br />
Kultivierung der Kinder durch anregende Beschäftigungen wie<br />
Basteln, Zeichnen und Musizieren, über die Gestaltung von Festen,<br />
sportliche Wettkämpfe und Ausflüge. Zentral war die<br />
bewusste Gestaltung eines »pädagogischen Bezugs« zu den Kindern<br />
über ein ausgewogenes Verhältnis von mütterlicher<br />
Zuwendung und reflektierten Eingehens auf die individuellen<br />
kindlichen Bedürfnisse. 282 Realisiert werden musste das Programm<br />
unter schwierigsten personellen Bedingungen. Die mit<br />
den Kindern zusammen im Heim Tür an Tür lebenden Erzieherinnen<br />
hatten zu Beginn der 1950er Jahre noch bis zu 20 Kinder<br />
zu betreuen. Als Innovation konnte schon gelten, dass sie zuerst<br />
täglich zwei Freistunden, dann zusätzlich einen freien Vormittag<br />
und schließlich sogar 14-tägig ein freies Wochenende<br />
erhielten. Trotz solcher kleinen Erleichterungen hielten die<br />
Erzieherinnen und Erzieher selten länger als zwei bis drei Jahre<br />
der Belastung stand und ohne Rückgriff auf Kurzzeitpraktikantinnen<br />
und Praktikanten aus Fachschulen für Erzieher wäre der<br />
Betrieb kaum aufrecht zu halten gewesen. Insgesamt bremsten<br />
die personelle und finanzielle Situation die eingeleiteten Entwicklungen.<br />
In St. Petri lebten in den 1950er Jahren jeweils zwischen 55 und<br />
etwa 65 Kinder, unter ihnen seit 1953 auch einige Mädchen,<br />
eine Innovation, mit der die Leitung dem »Mädchenwaisenhaus«<br />
Alten Eichen folgte, das zu dieser Zeit die ersten Jungen<br />
aufnahm. Im Jahr 1958 waren 12 Mädchen im Heim, man hatte<br />
die Lehrlingsabteilung zugunsten einer Gruppenverkleinerung<br />
aufgegeben und entschloss sich nun, dem koedukativen Konzept<br />
auch durch eine Namensänderung Rechnung zu tragen.<br />
Fortan hieß das Heim St. Petri-Kinderheim, Stiftung des St. Petri-<br />
Waisenhauses von 1692. 283<br />
Die in St. Petri behutsam vollzogene Öffnung zu einem moderneren<br />
Konzept blieb im Mädchenwaisenhaus Alten Eichen in<br />
den 1950er Jahren noch in den Anfängen stecken. Immerhin<br />
schaffte der seit 1946 amtierende Hausvater, ein Diakon ›alter<br />
Schule‹, 1950 die bisherige Anstaltskleidung ab, über kleinere<br />
Renovierungsarbeiten wurden die Wohnräume etwas wohnlicher<br />
gestaltet und die Essenseinnahme vom Speisesaal in die<br />
Gruppenräume verlegt. Grundsätzlich überlebten die tradierten<br />
Strukturen aber das Jahrzehnt. Der Tagesablauf blieb der alter<br />
Waisenhäuser. 284 Und auch in den pädagogischen Methoden<br />
blieb man den alten Traditionen treu. Beliebteste Strafmethoden<br />
waren, neben rituell vollzogenen Schlägen im Büro des<br />
Hausvaters, »mit dem Gesicht zur Wand stehen« und »sich im<br />
Kartoffelkeller besinnen.« 285<br />
Die Personaldecke war in Alten Eichen noch dünner als in St. Petri.<br />
Für 60 Kinder standen 1958 neben dem Hausleiterehepaar lediglich<br />
drei Kindergärtnerinnen und zwei Kinderpflegerinnen zur<br />
Verfügung (dazu kamen einige der schulentlassenen Mädchen,<br />
die als »Haustöchter« im Heim blieben). Noch Ende der 1950er<br />
Jahre betreute eine Erzieherin, die in Alten Eichen »Tante« genannt<br />
wurde, bis zu 25 Kinder. In den Urlaubszeiten einer Kollegin<br />
waren es bis zu 40. Dazu mussten sich die Erzieherinnen dem<br />
Heimreglement unterordnen und Herrenbesuch auf dem Gelände<br />
wurde nur ungern gesehen. 286<br />
Veränderungen erfolgten allerdings in struktureller Hinsicht.<br />
1951 öffnete man sich auf Vorschlag des Wohlfahrtsamts für<br />
Jungen. Dies führte auch hier 1953 zur Namensänderung in<br />
»Kinderheim Alten Eichen. Heim für Mädchen und Jungen der<br />
Stiftung Mädchenwaisenhaus.« In diesem Zuge wurde man<br />
gleichzeitig, auch auf Anregung der Behörde, zusätzlich ein Binnenschiffer-Heim,<br />
was sich positiv auf die Finanzlage auswirkte.<br />
Alten Eichen betreute jetzt also zwei unterschiedliche Gruppen<br />
von Kindern: Auf der einen Seite standen die Jugendamtskinder<br />
und auf der anderen die von ihren Eltern primär zur schulischen<br />
Versorgung ins Heim gebrachten Binnenschifferkinder. 287<br />
Obwohl die Jugendamtskinder dies als Zwei-Klassen-System<br />
wahrnahmen, brachte es auch für sie den Vorteil, dass man sich<br />
räumlich mehr leisten konnte. Ein zweigeschossiger Anbau mit<br />
mehreren kleineren Schlafräumen wurde 1956 eingeweiht,<br />
womit für einen Teil der Kinder das bisherige Provisorium tagsüber<br />
nicht zugänglicher größerer Schlafräume endete.<br />
4.2.3 Auswärtige Unterbringungen<br />
Sowohl Kinder als auch Jugendliche wurden nicht nur in bremischen<br />
Heimen, sondern auch in Heimen anderer Bundesländer<br />
untergebracht. Wie viele es waren und in welche Heime sie<br />
kamen, ist für die 1950er Jahre aber nicht offiziell dokumentiert.<br />
In amtlichen Berichten findet sich allenfalls sporadisch die<br />
Anmerkung, dass man sich auch auswärtiger Heime bedienen<br />
musste. In den Darstellungen der Heime wird an einigen Stellen<br />
darauf hingewiesen, dass man sich gezwungen sah, Kinder, insbesondere<br />
schwierige Jugendliche, nach auswärts zu verlegen.<br />
Insoweit können lediglich Vermutungen geäußert werden:<br />
Dass sich Bremerhaven in seiner Unterbringungspolitik primär<br />
auf Heime außerhalb seiner Stadtgrenzen konzentrieren<br />
musste, ergibt sich schon daraus, dass es für Fürsorgezöglinge<br />
über kein eigenes Heim verfügte. In den 1950er Jahren waren<br />
aber, laut der Jahresberichte des Jugendamtes, zwischen 42<br />
und 73 Jugendliche im Rahmen einer Fürsorgeerziehung in<br />
einem Heim untergebracht. Auch die Plätze in den Kinderheimen<br />
reichten nicht aus. Im Säuglingsheim und in Hohewurth<br />
93